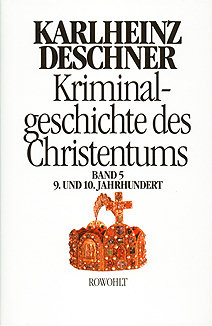![Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert]()
Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert
Dekretalen. Von sämtlichen Pseudo-Isidorien hatten sie die stärkste historische Wirkung und waren in allen mittelalterlichen Kirchenrechtssammlungen das wohl am weitesten verbreitete Opus. Immer wieder zog man es heran, um Roms Macht zu stützen und zu mehren. Nicht zuletzt insistierten natürlich die Päpste selber darauf. Nikolaus I., Hadrian II., Gregor V., Leo IX., Gregor VII. u.a. haben es zu politischen Zwecken ausgebeutet. Der berüchtigte »Dictatus papae« Gregors fußt zum größten Teil auf diesem ungeheuerlichen Schwindel. Im Investiturstreit wurde er voll rezipiert; er spielte in den Kämpfen zwischen Kaisern und Päpsten des 11. und 12. Jahrhunderts eine außerordentliche Rolle. Das Fälschungswerk, schreibt Manfred Hellmann, hat »die Stellung und das Ansehen des Heiligen Stuhles in ungeahnter Weise gehoben«. Es war »das willkommenste Geschenk«, sagt Walter Ullmann, »das das Papsttum je erhalten hat«. Zumal es verstand, daraus am meisten zu profitieren und die von den Betrügern vielleicht noch mehr begünstigten Bischöfe um diesen Vorteil zu bringen.
Der Einfluß der Pseudoisidorischen Dekretalen auf Kirche und Kirchenrecht, spätestens seit dem frühen Hochmittelalter enorm, ist bis ins 19. Jahrhundert groß, in dem aus dem Blendwerk etwa das Unfehlbarkeitsdogma Pius' IX. gewaltigen Nutzen zog, weshalb auch der Papst noch nach 1870, Jahrhunderte nach der definitiven Aufdeckung der grandiosen Gaunerei, Autoren, die weiter daran festhielten, ausdrücklich gelobt hat! (Verdientermaßen erfolgte zu Pius' IX. Heiligsprechung 1985 der erste Schritt mit der offiziellen Anerkennung seiner »heroischen Tugend« – einst erklärten ihn katholische Bischöfe, katholische Kirchenhistoriker und Diplomaten für dumm und verrückt: vgl. meine Politik der Päpste im 20. Jahrhundert I 23 f.).
Der sagenhafte Streich der Pseudo-Isidorien aber wirkt beinah bis heute fort, bis zum Codex Iuris Canonici von 1917, der beispielsweise dem Papst das alleinige Einberufungsrecht zu einem ökumenischen Konzil vorbehält. Als 1962 Johannes XXIII. ein solches berief, konnte er sich auf nicht weniger als sechs Belegstellen im CIC stützen – drei aus den Pseudoisidorischen Dekretalen, drei von ihnen abgeleitet. 13
Da es aber für die Prediger des Jenseits nichts Wichtigeres als Geld und Gut im Diesseits gibt, geht es in den großen Fälschungen nicht zuletzt auch um den Zehnten, um Dienstleistungen an Sonn- und Feiertagen, den Schutz des Kirchengutes, die Unverletzbarkeit und Unveräußerbarkeit von geistlichem Besitz. Was immer der Klerus einmal bekam, Felder, Bücher, Häuser, Kleider, Flüsse etc., alles bewegliche und unbewegliche Gut, wird zu Kirchengut und jedes Antasten desselben mit Exkommunikation, Verlust aller Würden und schwersten Strafen vor dem weltlichen Gericht gesühnt. 14
Anastasius Bibliothecarius oder Ein Gegenpapst debütiert
Schon Leo IV., während dessen Amtszeit die Pseudoisidorischen Fälschungen entstanden, hatte sie benutzt. Als er am 17. Juli 855 starb, wollte man an seine Stelle den Kardinalpriester Hadrian setzen. Da dieser, ein seltener Fall in der Papstgeschichte, aber ablehnte – vielleicht weil er sich später bessere Chancen errechnete (womit er, trifft dies zu, auch recht behalten hätte) –, wählte die Mehrheit jetzt Benedikt III. (855–858), einen gebürtigen Römer.
Zwar war Kardinal Benedikt bereits in feierlicher Prozession nach dem Lateran geführt, auch das Wahldekret, von Klerus und Adel unterzeichnet, dem Kaiser mit der Bitte um Bestätigung geschickt worden. Doch gerade eine kaisertreue Gruppe hatte den hochadeligen, hochbefähigten und sogar hochgebildeten Kardinal Anastasius (Bibliothecarius) als Papst erkoren: nicht nur, so Wattenbach, »ein gelehrter Mann und schlauer Fuchs«, sondern auch Sohn des reichen Bischofs Arsenius von Orte, den übrigens Anastasius selbst (in einem Brief an Erzbischof Ado) fälschlich Onkel nennt (wie noch Katholiken des 20. Jahrhunderts, Seppelt etwa; andere ignorieren das Faktum).
Kardinal Anastasius aber war in Gegensatz zum letzten Papst getreten und offenbar aus Furcht vor Rache fünf Jahre seiner römischen Kirche ferngeblieben. Als ebenso einfluß- wie kenntnisreicher hochgescheiter Rivale wurde er von Leo IV. fast während seines ganzen Pontifikats erbittert bekämpft und auf mehreren Synoden, Ende 850 sowie im Mai, Juni und Dezember 853, exkommuniziert, gebannt und abgesetzt – eine in St. Peter durch Bild mit Kommentar
Weitere Kostenlose Bücher