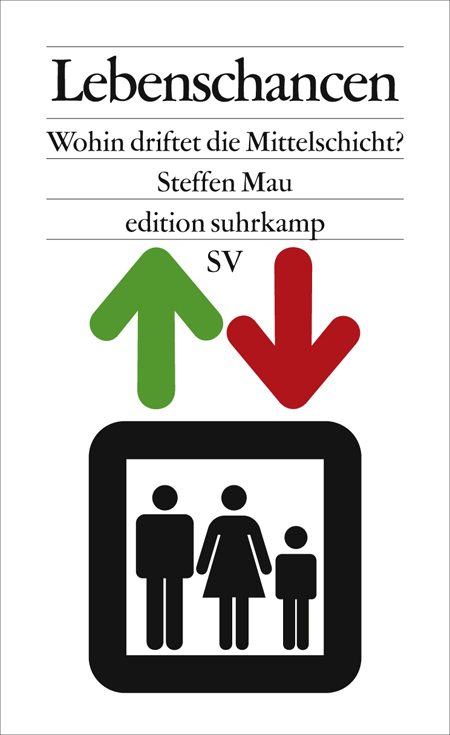![Lebenschancen]()
Lebenschancen
arbeiten; vielmehr komme es zunehmend darauf an, sich bietende Gelegenheiten clever zu nutzen. Solche Chancen können flüchtig sein, man denke beispielsweise an die Castingshows, die jungen Leuten quasi über Nacht zu (vergänglicher) Prominenz verhelfen. Ein anderer, struktureller Mechanismus, der hier eine Rolle spielt, ist die soziale Schließung. Darunter verstehen Soziologen seit Max Weber einen Prozess, im Zuge dessen Gruppen ihre Vorteile zu maximieren suchen, indem sie den Zugang zu Positionen und Privilegien auf einen begrenzten Kreis von Auserwählten beschränken. Soziale Schließung heißt: Monopolisierung von Chancen auf Erfolg; sie hebelt die Leistungsgerechtigkeit aus und sorgt dafür, dass Einzelne im Wettbewerb um begehrte Güter und Positionen einen entscheidenden Startvorteil haben.
Trotz solcher Einwände scheint der »Mythos Markt« jedoch gegen grundsätzliche Kritik immun zu sein. Skeptikern wird nicht selten unterstellt, sie wollten doch nur Neiddebatten führen (im Ausland gäbe es solche Diskussionen überhaupt nicht etc.). Vor allem diejenigen, die es sich auf dem Sonnendeck der Gesellschaft bequem gemacht haben, empfehlen den weniger Pri
vilegierten dann gerne, sie sollten doch einfach versuchen, »sich bitte selber nach oben zu hieven, statt die Begünstigten nach unten zu ziehen« (Neckel 2001a: 9). Kritik an der wachsenden Ungleichheit wird als leistungsfeindlich diffamiert; wer sie äußert, wolle letztlich die Falschen belohnen und schade einem System, von dem unser aller Wohlstand abhängt.
Doch gerade am Punkt der leistungsgerechten Verteilung entzündet sich ja die Kritik an der Marktgesellschaft. So sprechen einige Zeitdiagnostiker bereits von der Refeudalisierung sozialer Ungleichheit (Forst 2005; Neckel 2010). Sie meinen damit, dass Statuspositionen heute nicht mehr nach Leistung verteilt, sondern gleichsam vererbt werden. Damit schwindet allerdings die Durchlässigkeit der sozialen Schichten. Alles, was zählt, ist das Glück der Abstammung. Insofern nähern wir uns – so diese Kritiker – heute wieder Zuständen an, wie wir sie aus vormodernen Ständegesellschaften kennen:
»War soziale Ungleichheit dem modernen Selbstverständnis nach als ein graduelles Abstufungssystem unterschiedlicher Wettbewerbspositionen zu verstehen, mit Übergängen zwischen den einzelnen Klassen und Schichten, so wird Ungleichheit heute zunehmend durch kategoriale Unterschiede untereinander unvergleichbarer Soziallagen geprägt, weshalb nicht offene Statuskonkurrenzen, sondern Einschluss und Ausschluss bestimmend für die Soziallage sind.« (Neckel 2010: 13)
Eine zugespitzte, vielleicht sogar überzogene Interpretation, denn in unserer Gesellschaft gibt es schließlich beides: den Bonus bzw. Malus der Herkunft, aber auch Gelegenheiten, Herkunftsanker zu lichten. Man muss insofern differenzieren: Die soziale Vererbung als solche ist nicht unbedingt das Problem. Solange es Aufstiegskanäle gibt, die es ermöglichen, in höhere Ränge vorzustoßen, sind die Menschen durchaus bereit, die »schicksalsbedingte« Ungleichheit qua Geburt zu akzeptieren. Wir erleben jedoch, dass sich diese Kanäle immer häufiger als verstopft erweisen. Ganz allgemein geht aus repräsentativen Da
ten hervor, dass in Deutschland der (zukünftige) Status der Kinder sehr stark durch das Elternhaus vorgeprägt ist (siehe Pollak 2010): Im internationalen Vergleich ist die Durchlässigkeit der bundesdeutschen Gesellschaft relativ gering. Bei denen, die nach 1960 geboren wurden, nimmt der Zusammenhang zwischen Herkunft und eigener sozialer Position im Vergleich zur Geburtskohorte der fünfziger Jahre deutlich zu. Im Zeitvergleich zeigt sich außerdem, dass die Wahrscheinlichkeit sozialer Aufstiege (gemessen am Status des Vaters) abnimmt (eine Ausnahme sind die westdeutschen Frauen). Schon beim Studium sind Kinder aus unteren Schichten benachteiligt. Fast 70 Prozent der Studenten in Deutschland kommen aus einem Akademikerhaushalt. Reinhard Pollak hat berechnet (2010: 20), dass es weniger als ein Prozent der Kinder aus ungelernten Arbeiterhaushalten schaffen, in leitende Angestelltenpositionen aufzusteigen. Es geht hier nicht, so Pollak, um »vom Tellerwäscher zum Millionär«-Karrieren, allenfalls um moderate Aufwärtsmobilität in die obere Mitte. Mit Blick von unten nach oben kann man vermutlich zu Recht von einer mobilitätsblockierten Gesellschaft sprechen, wobei vor allem strukturelle Gründe (Ende der
Weitere Kostenlose Bücher