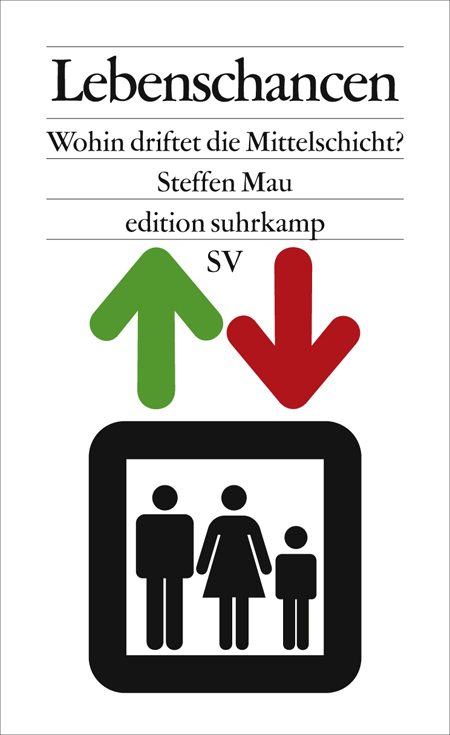![Lebenschancen]()
Lebenschancen
und damit gleich in die Schlagzeilen – geschafft hatte. Auf den Fluren ostdeutscher Behörden tummeln sich dagegen zahllose Wessis als Minister und Staatssekretäre. Von den derzeitigen Bundesministern stammt keiner aus dem Osten (unter Kohl waren es mal drei); es gibt keine(n) ostdeutschen Verfassungsrichter oder -richterin; auch die übrigen Bundesgerichte (das Bundessozialgericht, der Bundesfinanzhof, das Bundesarbeitsgericht, das Bundesverwaltungsgericht, das Bundespatentgericht, der Bundesgerichtshof) werden ausnahmslos von Westdeutschen geleitet; dasselbe gilt für die Chefetagen der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten (Ausnahme Karola Wille, seit November 2011 Intendantin des MDR ) sowie die überregionalen Tageszeitungen; auch unter den 500 reichsten Deutschen findet sich kein Ossi. In der Wissenschaft sieht es kaum anders aus, wenn man etwa die Führungsposten großer Wissenschaftsorganisationen oder die Direktoren/Präsidenten von Max-Planck- oder Leibniz-Instituten betrachtet. In meinem eigenen Fach, der Soziologie, liegt der Anteil der Professoren mit ostdeutscher Herkunft unter fünf Prozent (Mau/Huschka 2010). Natürlich tragen die älteren Generationen immer noch den Makel der Ostsozialisation, und es braucht Zeit, bis jüngere Wissenschaftler nachrücken, die ihre akademische Karriere im wiedervereinigten Deutschland absolviert haben. Doch selbst wenn man nur auf die jüngeren Mitglieder des Elitenolymps schaut, sind die Ostdeutschen die Nadeln im Heuhaufen. Die Kanzlerin und neuerdings der Bundespräsident bleiben als Ostdeutsche im bundesrepublikanischen Elitenorbit die Ausnahmen. Im Verlauf der nächsten Jahrzehnte wird sich dieses Ungleichgewicht vermutlich abschwächen, doch auch in 50 oder 60 Jahren werden Menschen aus den neuen Bundesländern in den Führungsetagen der Republik noch lange nicht entsprechend ihres Anteils an der Gesamtbevölkerung vertreten sein.
Auf anderen gesellschaftlichen Feldern stellt sich die Situation
jedoch ganz anders dar: Im Sport, wo Tore, Zeiten, Höhen oder Weiten zählen, haben es die Ostdeutschen problemlos in die vordersten Reihen geschafft. Das gilt auch im Theater, im Film- oder im Musikgeschäft, also überall, wo es spezielle Förderstrukturen unkonventionelle Wege zum Erfolg gibt, wo Herkunftskapital weniger zählt und Leistung direkter bewertet wird. Die Vermutung, dass bei der schwachen Repräsentanz der Ostdeutschen in vielen Bereichen nicht nur IQ und Bildungszertifikate eine Rolle spielen, drängt sich auf. Dass dieses Phänomen bis heute kaum öffentliche Kritik auf sich zieht oder gar politisiert wird, ist wohl vor allem dem Umstand geschuldet, dass Menschen aus den neuen Bundesländern, anders als Frauen oder manche Migranten, phänotypisch nicht als solche erkennbar sind.
Schließungsprozesse dieser Art sind nicht nur deshalb ein soziales Problem, weil dadurch Talent vergeudet wird. Sie bedeuten zugleich ein Abrücken vom Prinzip der Leistungsgerechtigkeit, das für das positive Selbstbild der alten Bundesrepublik so wichtig war. Dass auch die Kinder einfacher Arbeiter oder das sprichwörtliche katholische Mädchen vom Lande einen höheren Bildungsabschluss erringen konnten, war eine der wichtigsten Erfolgsgeschichten der Nachkriegszeit. Die Leistungsorientierung schuf und bestätigte das selbst gepflegte Image von der durchlässigen und offenen Gesellschaft. Zwar gibt es auch heute noch Vorzeigeerfolge, aber große Teile der Bevölkerung glauben nicht länger an das Versprechen, dass es ihren Kindern beinahe automatisch besser gehen werde als ihnen selbst und dass jeder es schaffen kann, wenn er sich denn wirklich anstrengt. In dieser Situation entsteht ein gefährliches Motivationsproblem, schließlich hängt Leistungsbereitschaft immer auch von der begründeten Hoffnung darauf ab, dass Einsatz sich lohnt. Wenn die Erfolgsaussichten der weniger Begüterten, der Unterprivilegierten oder der Mitte systematisch schmaler werden, kann das fatale Folgen für die Stimmung im Land haben und das Vertrauen in demokratische Institutionen erodieren lassen.
Mitunter gibt es natürlich völlig andere Einschätzungen. Auf einer Veranstaltung der Jungen Union gab Norbert Walter, der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, seinen Zuhörern Folgendes mit auf den Weg:
»[W]er Schülern von heute nicht vermitteln kann, dass sich ihre Chancen – so sie motiviert und gut ausgebildet werden – von denen aller ihrer Vorfahren deutlich,
Weitere Kostenlose Bücher