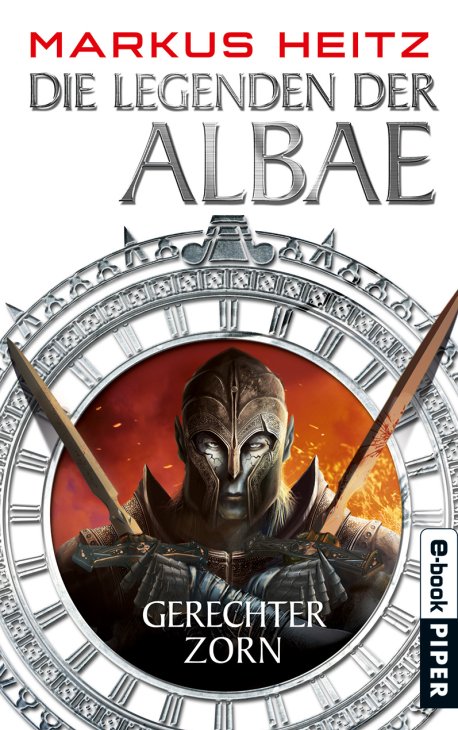![Legenden d. Albae (epub)]()
Legenden d. Albae (epub)
der vierten Insel bei Wèlèron.«
Sinthoras verriet mit nichts, dass er die Worte vernommen hatte.
Also machte sich Caphalor ebenfalls an den Abstieg, die viertausend Stufen hinab zum Plateau, wo sein Nachtmahr auf ihn wartete. Dabei ließ er den Blick schweifen.
Er sah auf den Nordteil von Dsôn, in dem sich viele Kuppelbauten erhoben. Unzähligen Augen gleich, schienen sie aus dem Boden des Kraters nach oben in den Himmel zu glotzen. Bunte Kuppeln gab es nur wenige, die meisten waren in Schwarz, Weiß, Silber oder in Metall gehalten. Einige Häuser hatten einen Anstrich, der in der Nacht glomm und das düstere Leuchten von glühenden Kohlen nachahmte. Dazwischen erhoben sich Türmchen und Türme, von denen einige wie Schilfrohre aneinanderlehnten und sich gegenseitig zu stützen schienen. Die Grundstücke in Dsôn waren so begehrt, dass selbst auf wenigen Quadratschritten Grundfläche ein Gebäude errichtet wurde. Das musste dann umso protziger sein, und so waren die Türme entstanden, die sich mitunter weit nach oben reckten.
Wie Nadelkissen, durchzuckte es Caphalor.
Die größten, prunksüchtigsten Gebäude standen rund um den Hügel des Beinturms, dann wurde es gemäßigter, bis zum Kraterrand, wo sich wiederum eine Anzahl von eindrucksvollen Bauwerken erhob.
Caphalor empfand den Anblick der Hauptstadt als eine nette Abwechslung zu seinem ländlichen Leben, aber mehr auch nicht. Gern ließ er sich faszinieren und nahm vielleicht auch eine Idee mit, um an seinem eigenen Haus etwas zu verändern. Aber hier zu wohnen, nein, das käme niemals infrage.
Am Ende würde ich noch Sinthoras’ Nachbar,
dachte er und musste zu allem Elend grinsen, was jedoch nicht über seine feste Absicht hinwegtäuschte: Sinthoras musste geschadet werden. Der Alb hatte ihm den Krieg erklärt – warum sollte er sich zurückhalten? Das bedeutete, dass er von nun an seine härtere Seite zeigen musste. Gerade, da es um die Mission ging, die über allen anderen Belangen stand.
Er war auf der Plattform angekommen und erreichte seinen Nachtmahr.
Das Tier war noch wild, tänzelte, sobald er Anstalten machte, sich in den Sattel zu schwingen. Aber etwas Besseres hatte er niemals geritten. Sein Nachtmahr war ursprünglich, unvergleichlich. Sardaî wurde nicht müde und schien die Geschwindigkeit eines schnellen Galopps zu genießen. Die lange schwarze Mähne wehte im Wind, der schnaubende Atem war regelmäßig und kaum angestrengt. Caphalor freute sich auf den Neid in Sinthoras’ Zügen, wenn er das Tier zum ersten Mal in Bewegung sähe. Eleganz, Kraft, Feuer.
Auf dem Nachhauseweg machte er sich Gedanken, was er Enoïla sagen durfte. Mehr als eine Andeutung würde er nicht machen können.
Aber eine Sache musste er vorher noch unbedingt angehen. Er wollte seiner Gemahlin keine Unordnung hinterlassen und denSklaven zu verstehen geben, dass sie zu gehorchen hatten, auch wenn er nicht anwesend war. Da passte es ausgezeichnet, dass er seine Tochter ins Lager der Sklaven bestellt hatte.
Es wurde dunkel, als Caphalor das Lager erreichte.
Sie saßen im Gemeinschaftshaus beim Abendessen zusammen, wie er am Lichtschein und an den Schatten hinter den Fenstern sehen konnte; von seiner Tochter entdeckte er nichts.
Caphalor stieg ab und betrat das Haus.
»Der Gebieter!«, rief der Oberaufseher und wies die Sklaven an, sich auf den Boden zu werfen und ihre Unterwürfigkeit zu bezeugen.
Die Männer, Frauen und Kinder folgten dem Befehl, aber es entging dem Alb nicht, dass der bärtige Grumson recht lange benötigte, um auf die Knie zu sinken. Auch der Blick, den er seinem Herrn zuwarf, sprach von mühsam unterdrückter Aufsässigkeit. Caphalor kam nicht zu früh, um seinen Untergebenen zu verdeutlichen, auf wessen Gnade sie angewiesen waren.
»Guten Abend, Vater«, sagte Tarlesa hinter ihm. »Verzeih die Verspätung. Ich musste noch Enali-Ranken vorbereiten. Morgen soll einem Sklaven das Blut ausgetauscht werden.«
»Ich bin eben erst eingetroffen.« Caphalor wandte sich zu ihr. »Ist der Sklave denn den Umstand wert?«
Tarlesa nickte. »Er ist der beste Drescher und Schmied, die anderen können noch viel von ihm lernen. Er hat sich verletzt und das Blut vergiftet. Wir lassen ihn beinahe leer laufen und geben ihm etwas Blut von seinem Bruder.« Sie lächelte. Dabei sah sie aus wie eine sehr junge Schwester seiner Gattin. Ihre Züge waren lediglich etwas kantiger, was er auf seinen Einfluss schob, und sie hatte seine Augen. Heute trug sie
Weitere Kostenlose Bücher