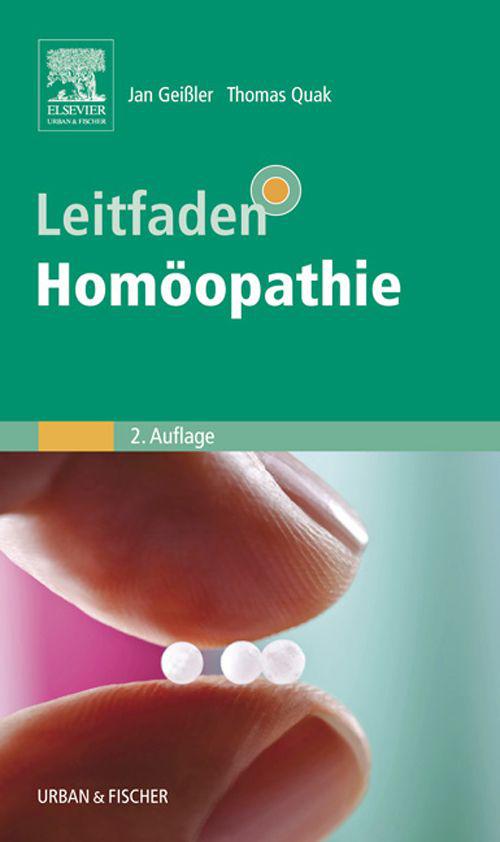![Leitfaden Homöopathie (German Edition)]()
Leitfaden Homöopathie (German Edition)
Rückenschmerzen, Tracheobronchitis, Halsschmerzen und Heiserkeit. Bei Fieber länger als 3–4 d Verdacht auf bakterielle Sekundärinfektion.
Verlauf: Bei komplikationslosem Verlauf klingen die Krankheitserscheinungen nach wenigen Tagen bis einer Woche wieder ab. Schnelle Ermüdbarkeit mit Schwitzen und allgemeines Erschöpfungsgefühl können noch mehrere Wochen anhalten.
„Grippaler Infekt“: Umgangssprachlicher Sammelbegriff für fieberhafte Allgemeinerkrankungen, die v.a. durch Viren, selten durch Bakterien hervorgerufen werden; meist Beteiligung der oberen Atemwege (Husten, Schnupfen, Heiserkeit); gelegentlich zusätzlich Übelkeit, Diarrhoe oder Obstipation. Liegt keine Immunschwäche vor, klingt der Infekt innerhalb von 5–14 d folgenlos ab.
Therapeutische Strategie
Für die homöopathische Behandlung gibt das klinische Erscheinungsbild den Ausschlag, sodass die Abgrenzung von Grippe und grippalem Infekt keine Konsequenzenhat. Die Grippe ist dankbar zu behandeln, sowohl was die Dauer als auch was die Schwere der akuten Erkrankung angeht. Auch ungeübte Homöopathen wie z.B. Mütter von erkrankten Kindern finden oft das passende Heilmittel, wenn sie das Krankheitsbild sorgfältig differenzierend beobachten. In unkomplizierten Fällen ist außer den homöopathischen „Hausmitteln“ i.d.R. keine weitere homöopathische Behandlung erforderlich. Auch Restbeschwerden und leichtere Komplikationen (z.B. Bronchitis, Otitis etc.) sind gut behandelbar, treten aber bei passender homöopathischer Behandlung in der Regel gar nicht erst auf. Kommt es zu bedeutenden Komplikationen wie Myokarditis, Pneumonie o.Ä., sollte die Behandlung unter Nutzung aller diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten dem Spezialisten vorbehalten bleiben.
Homöopathische Behandlung
Die Anwendung einfacher bewährter Indikationen bei Grippe ist für viele Anfänger das erste Erfolgserlebnis in der Homöopathie. Durch die akut und deutlich auftretenden Symptome ergeben sich klare Arzneianzeigen. Tritt eine echte epidemische Grippe auf, muss der Arzt den so genannten Genius epidemicus herausarbeiten, also das Arzneimittel, das die gemeinsame Symptomatik mehrerer Grippeerkrankter in der Gesamtheit deckt. In der Regel lassen sich so mit zwei bis drei Arzneimitteln die allermeisten Grippekranken erfolgreich therapieren. Wenn in der eigenen Praxis nicht ausreichend viele Patienten erkrankt sind, ist ein Austausch mit Kollegen während einer Epidemie sehr hilfreich, um den Genius epidemicus sicher bestimmen zu können.
Wahl der Symptome
Auch wenn die allgemeinen grippalen Symptome immer wieder ähnlich sind (Husten, Schnupfen, Fieber etc.), ist die individuelle Ausprägung doch jedes Mal anders. Deshalb müssen die Details im Einzelnen erhoben werden. Die Eigenarten des Fieberverlaufs bieten gute Anhaltspunkte für die Verordnung. Die sorgfältige Beobachtung der Ärzte aus der Zeit vor Erfindung des Fieberthermometers, die sich in der Homöopathie erhalten hat, soll wieder geübt werden! Die gemessene Fieberhöhe hilft dagegen nicht weiter. Daneben sind wie immer alle auffallenden Begleitsymptome, Auslöser, Stimmungsveränderungen und Modalitäten zu beachten:
Auslöser sind der Königsweg zum Akutmittel, sofern eindeutige vorhanden sind. Beispielsweise Durchnässung durch Schwitzen, kalter trockener Wind usw.
Zeitliche Muster, z.B. Tages- oder Nachtzeiten bei den jeweiligen Beschwerden, z.B. Husten nur beim Erwachen. Auch Periodizität.
Abfolge von Frost, Fieberhitze und Schweiß je nach Modalitäten. Für die Mittelwahl sind nur diese beobachtbaren Fieberstadien hilfreich, nicht aber die gemessene Fieberhöhe.
Temperaturabhängigkeit, z.B. Empfindlichkeit auf Frischluft, Umgang mit der Bettdecke (z.B. zugedeckt bis über beide Ohren, abgedeckt, nur die Füße abgedeckt etc.).
Schweiß: Zeiten, Auslöser, aber auch Geruch, Konsistenz, z.B. ölig, nur an unbedeckten Stellen, einseitig, nur bei geschossenen Augen usw.
Begleitsymptome, die meistens vorhanden sind wie Übelkeit, Erbrechen, Gliederschmerzen usw., wiederum mit möglichst genauer Beschreibung.
Verhalten des Patienten, beispielsweise verkriecht sich oder sucht nach Gesell-schaft.
Stimmung und Bewusstsein, z.B. delirant („typhös“), ängstlich, anhänglich, reizbar. Je mehr es vom gesunden Zustand abweicht, umso wichtiger.
Appetit und Durst: welche Speisen und Geschmacksrichtungen, wann? Was ist anders als sonst? Was ist bei Grippe unerwartet, z.B. Gier nach
Weitere Kostenlose Bücher