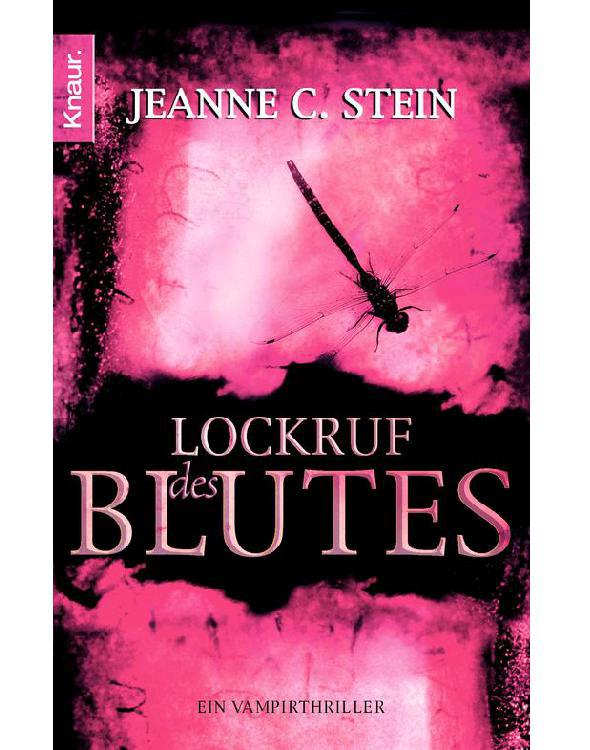![Lockruf des Blutes]()
Lockruf des Blutes
dreckigen, zerrissenen und geflickten Ledermantel sehen, die in betrunkener Entschlossenheit auf die Büsche zu wankt. Eine Obdachlose. Das wird mich praktisch unsichtbar machen für jeden, der nicht das Risiko eingehen will, angefasst oder angebettelt zu werden.
Das habe ich schon hundert Mal erlebt.
Ich schaffe es ins Gebüsch und zum Parkplatz dahinter, wo mein Taxi auf mich wartet. Der Fahrer, ein dunkelhaariger, dunkelhäutiger Latino, mustert mich argwöhnisch, als ich näher komme. Doch ich hole meine Geldbörse unter dem Mantel hervor und lasse ein paar Zwanziger aufblitzen. Die Unsicherheit verfliegt.
»Wo soll’s hingehen?«, fragt er.
Ich sage ihm, dass ich zum Polizeihauptquartier will.
Das entlockt ihm ein Lächeln. »Ah. Sie arbeiten undercover.«
Ich erwidere das Lächeln. »So ähnlich.«
Auf dem Rücksitz entspanne ich mich endlich. Ich lege mir zurecht, was ich Williams sagen will und wie ich ihm beibringen soll, dass ich schon die ganze Zeit über von dem Computer wusste. Dieser Gedanke bringt mich zu Bradleys Telefonat zurück.
Wie konnte Bradley von dem Computer wissen?
Von den möglichen Antworten wird mir ganz schwindlig. Als wir vor dem Polizeihauptquartier ankommen, habe ich es so eilig, Williams davon zu erzählen, dass ich ganz vergesse, den Mantel und die Perücke auszuziehen. Der Sergeant am Empfang hebt warnend die Hand, um mich aufzuhalten, als ich an ihm vorbeistürmen will.
»He, immer langsam, Ma’am«, sagt er. »Was kann ich für Sie tun?«
Ich werfe einen Blick auf das Namensschild an seiner Brusttasche. »Sergeant Harvey, ich muss dringend mit Chief Williams sprechen.«
Er ist ein gutaussehender Schwarzer mit kurzgeschorenem Haar und breiten Schultern, aber er sieht mich an, als wüsste er nicht recht, ob er mich beruhigen oder rausschmeißen lassen soll. »Chief Williams ist noch nicht im Haus, Ma’am«, sagt er.
»Ich weiß, dass er hier ist«, herrsche ich ihn an. »Er kommt jeden Morgen um sechs. Sagen Sie ihm, dass Anna Strong hier ist. Er wird mich sehen wollen.«
Sergeant Harvey zögert. Vermutlich überlegt er, dass er mich lieber durchsuchen sollte, bevor er sich auch nur kurz abwendet, um oben anzurufen. Ich versuche, ihm die Entscheidung leichter zu machen, nehme die Sonnenbrille ab und schlüpfe aus dem Mantel. Sofort gleitet seine Hand zu der Waffe an seiner Hüfte, während sein Blick auf mein Gesicht geheftet bleibt. Er beobachtet mich haargenau, als ich den Mantel zu Boden fallen lasse. Ich trage darunter dieselben Sachen wie gestern, Jeans und einen kurzen Baumwollpulli, der mir knapp bis zur Taille reicht. Der Pulli ist zwar nicht hauteng, doch wenn ich eine Waffe tragen würde, könnte man sie darunter deutlich sehen. Ich ziehe beide Hosenbeine ein Stück hoch, um ihn zu zeigen, dass ich auch an den Knöcheln keine Waffe verstecke.
»Wenn ich noch weiter gehen soll«, erkläre ich ihm, »brauche ich Rotlicht und scharfe Musik.«
Das entlockt ihm beinahe ein Lächeln. Seine Schultern entspannen sich, und er greift zum Telefon. Doch er behält mich im Auge, und ich zweifle nicht daran, dass er blitzschnell seine Waffe ziehen würde, falls ich irgendwelche hastigen Bewegungen versuchen sollte.
Also halte ich still.
Er spricht leise in den Hörer. Ich kann ihn trotzdem hören, und offenbar hat er Williams persönlich am Telefon. Sergeant Harvey beschreibt mich knapp, und dabei fällt mir die Perücke wieder ein. Ich setze sie ab und fahre mir mit den Fingern durchs Haar. Er korrigiert seine Beschreibung. Nun reicht sie offenbar aus. Er legt auf und gibt mir einen Code für den Fahrstuhl.
»Der Chief erwartet Sie.«
Ich sammele meine Verkleidung ein, richte mich auf und verschließe meine Gedanken. Ich muss gut aufpassen, was ich Williams enthülle. Zumindest erst einmal.
Williams erwartet mich, als sich die Fahrstuhltür öffnet. Er betrachtet den Mantel. »Du brauchst einen besseren Schneider«, sagt er. »Dieser Mantel hätte dir beinahe eine Verhaftung wegen Landstreicherei eingebracht.«
Er dreht sich um und geht zu seinem Büro. Der verlockende Duft von frisch gebrühtem Kaffee schlägt mir an der Tür entgegen. Williams versucht anscheinend nicht, in meinen Geist einzudringen, und sein Verhalten wirkt höchstens milde neugierig.
Ich werfe einen begehrlichen Blick auf die Kaffeekanne. »Könnte ich davon vielleicht einen Schluck haben?«
Er sieht mich an, ein fragendes, halbes Lächeln spielt um seine Mundwinkel, und er bedeutet mir
Weitere Kostenlose Bücher