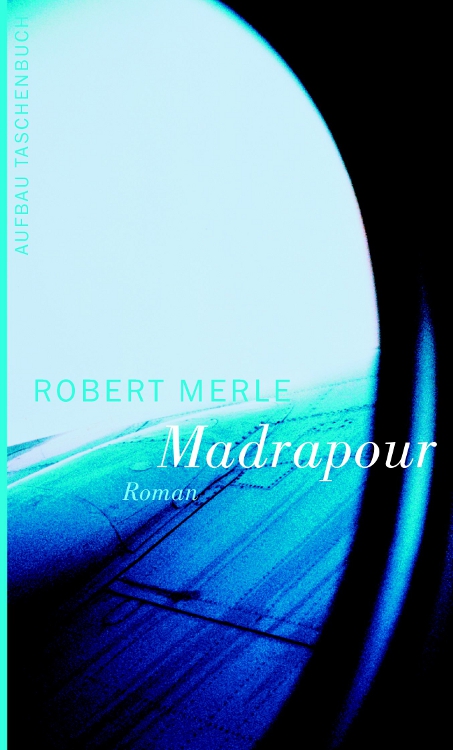![Madrapour - Merle, R: Madrapour]()
Madrapour - Merle, R: Madrapour
zu eigen machte.
Diese Nacht war, wenigstens an ihrem Beginn, »die glücklichste meines Lebens«: ein absurder Superlativ, den man logischerweise nur in den allerletzten Atemzügen anwenden dürfte, sofern man dann noch Muße hätte, Bilanz zu ziehen.
Was ich jetzt erzählen will, kann ich im übrigen nicht für absolut sicher ausgeben. Wenn man die Euphorie in Rechnung stellt, zu der mir das Oniril verholfen hatte –
vor
der Episode, die ich berichten werde, in einen Glückszustand mich versetzend, der eigentlich ihr Ergebnis hätte sein müssen –, kann man sehr wohl denken, daß ich meinen Sessel nicht verlassen habe und alles sich in meiner von der Droge überreizten Phantasie abgespielt hat.
Damit das Gegenteil bewiesen wäre, müßte sich das Ereignis wiederholen. Leider habe ich die Gewißheit, daß es eine Wiederholung nicht geben wird. In Anbetracht dessen stelle ich mir unaufhörlich die Frage: Worin unterscheidet sich eine
einmalige
Erinnerung von einem Traum?
Ich kann es nicht eindeutig entscheiden, weil bestimmte Träume durch ihren zusammenhängenden Verlauf, durch ihre Anschaulichkeit, ihre innere Logik und die Fülle der Details einen Eindruck von wirklichem Geschehen vermitteln, der selbst beim Erwachen nicht völlig verfliegt. Hat man umgekehrt in bitteren Augenblicken der Einsamkeit und des Scheiterns nicht das Gefühl, daß die Erinnerungen, die uns bedrängen – zum Beispiel eine »große Liebe«, von der wir Monate oder Jahre glaubten, daß sie erwidert würde –, eher Träume als wirkliche Erlebnisse gewesen sind?
Kurz nach dem Imbiß (aber ich habe jedes Zeitempfinden beinahe verloren) sehe ich das bezaubernde Gesicht der Stewardess über mich gebeugt. Ihre grünen Augen ruhen mit einem so sanften, so zärtlichen, so vielversprechenden Ausdruck auf mir, daß ich abermals, nur hundertfach verstärkt, das Gefühl zu fliegen habe, mit dem ich eingeschlafen bin. Ich nehme an, sie steht, aber ich sehe ihren Körper nicht, nur wie in Großaufnahme das Gesicht über mir. Ich sehe sie ganz nahe, als läge sie in voller Länge auf mir, in jener Position, die eine Frau wie sie wohl leiden mag, wissend, daß ihr Körper ihrem Partner so rührend schlank und leicht erscheinen wird.
In Wirklichkeit kann die Stewardess diese Position nicht eingenommen haben. Der Sessel, in dem ich halb ausgestreckt liege, macht sie unmöglich, und außerdem spüre ich nicht ihr Gewicht. Sie berührt mich nicht, sie ergreift nicht einmal meine Hand: Ihr Gesicht scheint wenige Zentimeter über meinem zu schweben, und es wäre unbewegt gewesen, hätten ihre Augen nicht gesprochen.
Auch ihr Mund lebt. Nein, er ist nicht »zu klein«, wie ich unbesonnenerweise sagte, denn was ihm an Größe fehlt, wird mehr als wettgemacht durch ihre geschwungenen kindlichen Lippen und die Besonderheit ihres Lächelns, bei dem er sich kaum öffnet. Eine Doppeldeutigkeit liegt in ihrem Gesichtsausdruck, so zärtlich er sein mag. Der Blick ist ernst, der Mund verspielt.
Der Kopf der Stewardess – allein der Kopf, weil ich den Körper nicht sehe – bleibt lange über mir wie in der Schwebe, während mich Wärme in konzentrischen Wellen bis in die Hände und Füße durchströmt. Ihre Augen ruhen fast starr auf den meinen, aber die Lippen bewegen sich unmerklich wie die eines knabbernden, zuschnappenden Kätzchens.
Der Moment, auf den ich warte, kommt endlich. Leise, jedoch mit einer gewissen Feierlichkeit sagt die Stewardess: »Heute ist der 15. November.« Und drückt ihre kindlichen Lippen auf die meinen, als wäre es schon lange so zwischen uns vereinbart.
Ich bin erstaunt, daß der Kreis diesen Kuß sieht und trotzdem in keiner Weise reagiert, nicht einmal leise kommentiert, was insbesondere den
viudas
als schockierender Verstoß gegen die Etikette erscheinen müßte.
Im Augenblick fühle ich mich nicht ertappt, denn ich sehe den Kreis ebensowenig wie den Körper der Stewardess. Bis auf ihr Gesicht scheint alles von Nebel umhüllt zu sein. Und auch das Gesicht verschwindet, als ihre warmen, frischen Lippen mit den meinen verschmelzen.
Wieder einmal lassen mich meine Sinne im Stich. Ich bin außerstande, gleichzeitig den Anblick und die Berührung zu genießen. Im selben Moment, wo ich die Lippen der Stewardess spüre, empfinde ich einen kurzen dumpfen Schmerz: Ich bin ihr zu nahe, ich kann sie nicht mehr sehen.
Ich habe mich gefragt – im nachhinein –, warum die Stewardess mich aufgefordert hat, diesen 15. November als
Weitere Kostenlose Bücher