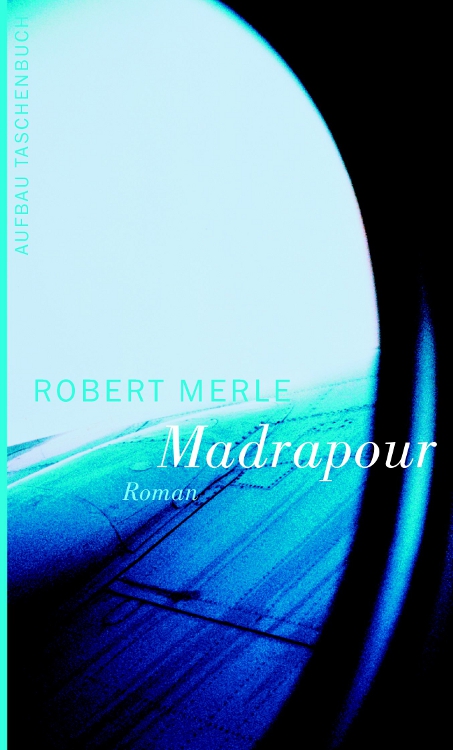![Madrapour - Merle, R: Madrapour]()
Madrapour - Merle, R: Madrapour
andere Möglichkeit, die ich nicht ausschließen kann, obwohl sie mich schaudern macht. Habe ich mir vielleicht von Anfang an, nicht unter Drogeneinfluß, sondern allein durch meine eigene Leidenschaft vergiftet, die Blicke, das Lächeln, den wechselnden Tonfall der Stimme, die Finger in meiner Hand – »liebevolle kleine Lebewesen« – nur eingebildet?
Wenn ich das alles wirklich geträumt habe, wenn die Stewardess von Anfang an nur eine Fremde für mich war, wenn diese unermeßliche Liebe nichts anderes gewesen ist als eine Ausgeburt meiner Phantasie, dann gibt es nichts mehr auf der Welt, dessen ich sicher wäre. Nichts von alledem, was ich erzählt habe, wäre verbürgt. Ich bin der einzige, anfechtbare Zeuge einer Geschichte, über die niemand die Wahrheit zu erfahren vermag.
Meine Beklemmung legt sich allmählich. Ich fühle mich besser. Aber diesmal weiß ich, daß es das Oniril ist, das seine Wirkung tut. Egal. Wichtig ist, daß ich zu dem Ereignis und zu meinem eigenen Schicksal einen wunderbaren Abstand gewinne. Man könnte sagen, daß mich das alles nicht mehr betrifft. Ich beobachte es beinahe belustigt aus der Ferne, aus großer Ferne. Alles verflüchtigt sich. Ich falle nicht länger auf meine eigene Geschichte herein. Ich merke endlich: alles, was mit diesem Flugzeug zusammenhängt, ist von beängstigender Falschheit. Die Chartermaschine fliegt nicht nach Madrapour, das Oniril ist kein heilendes Medikament. Meine Krankheit ist ein vorgetäuschter Irrtum. Die Stewardess liebt mich nicht.
Aber was liegt mir schon daran! Mit einem Gefühl unglaublicher Leichtigkeit löse ich mich zusehends vom
Rad der Zeit
. Als ob ich gar nicht mehr unter ihnen wäre, lasse ich meinen Blick über die Passagiere schweifen. Diese doppelzüngigen Brüder lächeln mir ermutigend zu, als wollten sie mich ebenfalls glauben machen, daß meine tödliche Schwäche ein »Irrtum« sei, der im Handumdrehen behoben werden kann. Mich berührt diese kleine Komödie nicht. Ich bin nicht einmal entrüstet. Mir ist alles einerlei. Sogar der heftige Streit, der in diesem Moment ausbricht. Ich höre dem nichtigen Wortwechsel gelassen zu.
Nach dem Frühstück, bei dem ich nur einige Schluck Tee getrunken habe, hat sich die Murzec ins Cockpit zurückgezogen. Blavatski macht sich über sie lustig, die
viudas
tauschen Blicke; Caramans hat die Lider halb geschlossen und trägt seine steife, blasierte Miene zur Schau: für ihn kommt zum Beten nur eine katholische Kirche in Frage, und der einzige Gott, an den man sich wenden könnte, ist der aus dem Neuen Testament.
Als die Murzec von ihrer Andacht zurückkehrt, leuchten ihre blauen Augen in der Hoffnung auf ein »anderswo, wo es vielleicht schön ist«, wie Robbie sagt. Gleichzeitig strömt sie über vor unverbrauchter Hilfsbereitschaft für ihre leidenden Brüder, und bevor sie wieder ihren Platz einnimmt, versäumt sie nicht, neben meinem Sessel stehenzubleiben und mich mit honigsüßer Miene zu fragen: »Wie geht es Ihnen denn heute, Mr. Sergius?«
»Danke, viel besser«, sage ich mit schwacher Stimme.
Die Murzec lächelt mir aufmunternd zu.
»Sie werden sehen, bald sind Sie wieder gesund …«
»Aber sicher, aber sicher«, sage ich leichthin.
»Außerdem hat der BODEN durchblicken lassen, daß Ihre Krankheit ein Irrtum war. Der BODEN kann sich nicht täuschen.«
»Mich kann er auch nicht täuschen.«
»Ganz gewiß nicht«, beteuert sie. »Das ist völlig ausgeschlossen.«
Trotz der Distanz, die ich jetzt gewonnen habe, mißfallen mir diese gutgemeinten Worte. Ich schließe die Augen, um deutlich zu machen, daß mich die Unterhaltung ermüdet.
»Indessen beten wir alle für Ihre baldige Genesung«, fährt die Murzec fort und bezieht den Kreis mildtätig in ihre Aufwallung von Barmherzigkeit ein.
»Ich bin Ihnen sehr verbunden«, sage ich, ohne die Lider zu heben.
Schweigen. Ich spüre genau, daß die Murzec glaubt, ihren verbalen Verpflichtungen noch nicht Genüge getan zu haben. Soll sie ihnen Genüge tun! Aber ohne mich! Ich halte die Augen geschlossen.
»Wenn ich etwas für Sie tun kann, sagen Sie es mir«, fügt sie hinzu.
Ja. Zum Beispiel mich in Ruhe lassen! Aber das sage ich nicht, die eingeschliffene Höflichkeit obsiegt, und ich murmle mit hartnäckig gesenkten Lidern: »Danke, Madame, aber die Stewardess tut alles, was nötig ist. Wie Sie gesehen haben, hat sie mir sogar die Hand gehalten.«
Dieser letzte Satz ist mir gegen meinen Willen entschlüpft, als ob
Weitere Kostenlose Bücher