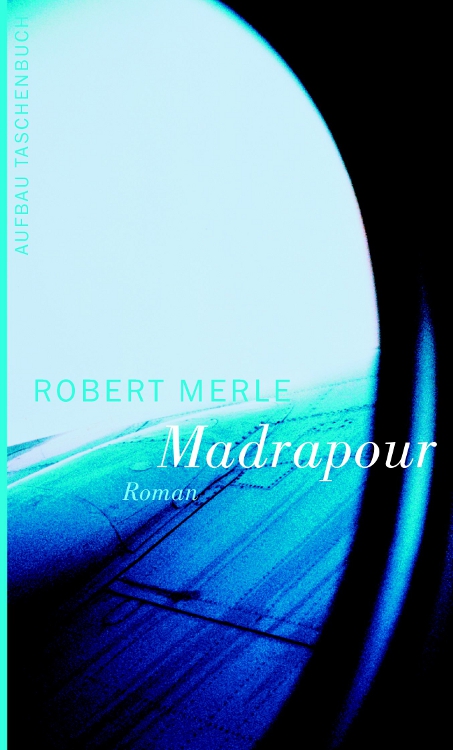![Madrapour - Merle, R: Madrapour]()
Madrapour - Merle, R: Madrapour
groß, daß sie die Stewardess um Kopfeslänge überragt und also völlig ungehindert ihre Waffe auf alle Passagiere im Kreis richten kann.
»Meine Assistentin spricht die europäischen Sprachen nicht«, sagt der Inder. »Hingegen hat sie sehr scharfe Augen und wird ohne Warnung auf jeden schießen, der die Unbesonnenheit begehen sollte, seine Hände zu bewegen. Ich selbst werde mich jetzt der Besatzung bemächtigen.«
Doch vorläufig unternimmt er nichts. Er rührt sich nicht. Er zögert noch. Man könnte meinen, daß es ihm widerstrebt, uns mit seiner furchteinflößenden Gefährtin allein zu lassen. Er fürchtet wohl, daß sie in seiner Abwesenheit zu schnell den Finger am Abzug haben könnte. Er geht zu ihr hin und sagt ihr leise etwas ins Ohr. Ich verstehe nicht, was er sagt, aber er scheint ihr zu raten, sich zu mäßigen. Sie hört unbewegt zu, ohne daß ihre Augen auch nur im geringsten ihren wilden Ausdruck verlieren.
Er stößt einen leichten Seufzer aus, zuckt die Achseln, läßt den Blick über uns schweifen und sagt liebenswürdig, aber mit jenem
high-class- Akzent
, der seinen Worten etwas Spöttisches verleiht:
“Good luck!”
Dann geht er an seiner »Assistentin« vorbei, schiebt den Vorhang zur Bordküche beiseite, bückt sich und verschwindet. Ich rutsche in meinem Sessel hin und her, und die Stewardess sagt ruhig:
»Seien Sie unbesorgt, Mr. Sergius. Niemand ist in Gefahr. Es wird überhaupt nichts passieren.«
Ich sehe sie erstaunt an. Ich erkenne sie nicht wieder. Ich habe sie blaß, zitternd und verkrampft gesehen, als sie die Fragen der Murzec nicht beantworten konnte, und jetzt lächelt sie, scheint ausgeglichen und selbstsicher zu sein. Ich begreife auch nicht, wie sie behaupten kann – im Ton eines Erwachsenen, der Kinder beruhigen will –, daß überhaupt nichts passieren wird, obwohl zwei bewaffnete Fanatiker uns als Geiseln genommen haben.
Nichtsdestoweniger gibt mir die Haltung der Stewardess etwas von meiner Kaltblütigkeit wieder. Ohne meine Hände zu bewegen – die Antwort, dessen bin ich sicher, käme auf der Stelle –, ergreife ich eine Initiative: ich wende mich auf Hindi an die Frau.
»Was bezwecken Sie eigentlich?« frage ich so gelassen wie möglich. »Wollen Sie politische Gefangene befreien oder ein Lösegeld bekommen?«
Die Frau zuckt zusammen, runzelt dann die Brauen, schüttelt langsam den Kopf und gebietet mir, ohne den Mund aufzumachen, mit ihrem Revolver Schweigen. In ihren großen schwarzen Augen lodert ein so mächtiger Haß, daß ich es mir gesagt sein lasse. Ich weiß im übrigen nicht, was ich von ihrer Verneinung halten soll. Sie scheint völlig sinnlos zu sein, weil sie ja die beiden Möglichkeiten, die ich nannte, in Bausch und Bogen verwirft.
Schließlich sage ich mir, daß das Mienenspiel der Inderin nur eine Bedeutung haben kann: sie verweigert das Gespräch mit Leuten, die sie möglicherweise niederzuschießen hat. Der Schweiß rinnt mir über den Rücken. Ich habe die unsinnige, aber niederschmetternde Vorstellung, daß die Wahl auf mich fallen wird, wenn die Inderin in der Folge eine Geisel töten soll.
Ich kann es kaum abwarten, bis der Inder zurückkommt und wieder Herr der Situation ist. Ich glaube, diese Empfindung wird rundum geteilt. Die Spannung im Kreis ist unerträglich geworden, seit er uns mit dieser Fanatikerin allein gelassen hat.
Das runde Gesicht von Mrs. Boyd nimmt plötzlich einen verzweifelten Ausdruck an, und sie sagt mit zitternder, kindlicher Stimme: »Mr. Sergius, da Sie ja die Sprache dieser Leute sprechen,könnten Sie diese … farbige Person fragen, ob ich eine Hand bewegen darf, um mich an der Nase zu kratzen?«
Die Inderin zuckt mit den Brauen und sieht Mrs. Boyd und mich drohend an, die Waffe abwechselnd auf einen von uns beiden richtend.
Ich bleibe stumm.
»Ich bitte Sie, Mr. Sergius«, sagt Mrs. Boyd, »meine Nase juckt schrecklich.«
»Es tut mir leid, Mrs. Boyd. Sie sehen selbst, die Inderin duldet nicht, daß man sie anspricht oder daß wir untereinander reden.«
Der Blick der Inderin flammt erneut auf, und sie stößt mehrere unartikulierte kehlige Laute aus. Aber mehr als der Klang erschreckt mich der Blick. Ich habe solche Augen nie gesehen. Groß, glänzend und von intensiver Schwärze, strahlen sie grenzenlose Bösartigkeit aus.
Es ist wieder still, und ich halte den Zwischenfall schon für abgeschlossen, als Mrs. Boyd mit der ängstlichen Stimme eines kleinen Mädchens abermals zu jammern
Weitere Kostenlose Bücher