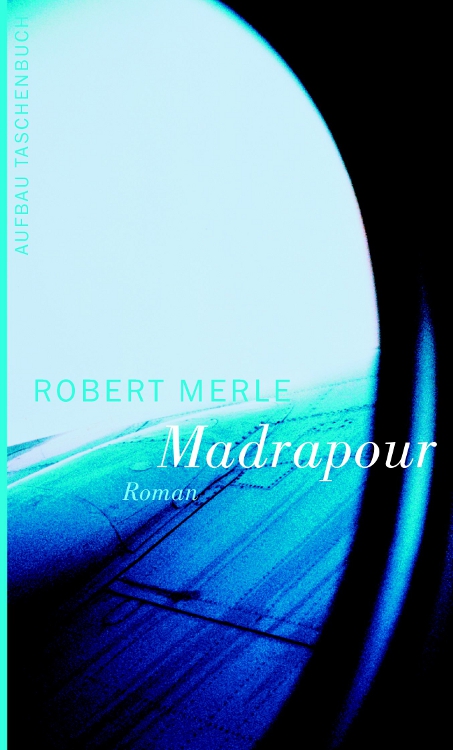![Madrapour - Merle, R: Madrapour]()
Madrapour - Merle, R: Madrapour
jeglichen Dialog mit uns verweigert, gleichzeitig aber alles hören kann, was wir sagen.«
Der Inder spricht jetzt völlig gelöst, ohne Ironie und Verachtung, ganz so, als wäre er einer von uns. Darüber könnte man fast vergessen, daß er eine Waffe in der Hand hält und seine Assistentin auf uns angelegt hat.
»Ich bin nicht einverstanden«, sagt Blavatski mit zitternder Stimme. »Es gibt keinen Beweis dafür …« Er unterbricht sich. Seine stechenden grauen Augen hinter den dicken Brillengläsern nehmen einen unruhigen Ausdruck an. Er schluckt und fährt mühsam fort: »Es gibt keinen Beweis dafür, daß der BODEN unsere Gespräche hört.«
Während ich Blavatski beobachte, gewinne ich den Eindruck, daß er schneller als sonst jemand von uns – auf jeden Fall schneller als ich – herausgefunden hat, worauf der Inder hinauswill. Und genau wie der Inder sagt er der Boden, wobei ich nicht recht zu präzisieren vermag, worin das Besondere dieser Art liegt.
»Es gibt im Augenblick keinen Beweis dafür«, sagt der Inder im Tone einer höflichen Konversation. »Aber wir werden darüber bald Gewißheit haben.«
Blavatski zuckt zusammen, und der Inder sieht uns an, als wüßte er weit mehr. In seiner Stimme war ein kleiner Peitschenhieb, doch ich begreife nicht, warum Blavatski seine Worte als so bedrohlich empfindet. Der Inder wendet sich an Pacaud.
»Erschien Ihnen im Cockpit, von der Funkanlage abgesehen, alles normal?«
»Ich weiß nicht«, entgegnet Pacaud, über dessen glänzenden Schädel wieder Schweißtropfen rinnen. »Ich weiß nicht, wie das Cockpit in einem ferngesteuerten Flugzeug normalerweise beschaffen ist. Das Instrumentenbrett kam mir sehr kahl vor, aber das ist letztendlich erklärlich, da es vermutlich von niemandem abgelesen wird. Was ich mir dagegen nicht erklären kann, ist das kleine rote Licht, das ständig in der Mitte des Instrumentenbrettes leuchtet.«
»Eine Kontrollampe?« fragt der Inder. »Ein Alarmsignal?«
»Aber Alarm für wen?« sagt Pacaud. »Es ist doch kein Pilot da.«
»Auch ich habe das kleine rote Licht gesehen«, sagt der Inder.
Seine regelmäßigen braunen Züge scheinen ihre Starrheit zu verlieren und ein gewisses Unbehagen zu verraten. Aber das ist Momentsache, und er kehrt sogleich wieder zu seiner Gelassenheit zurück, wie man eine Maske überstreift.
Drückendes Schweigen breitet sich aus und wird, je länger es anhält, um so unerträglicher. Sicher fehlt es uns nicht an Bereitschaft, unser Schicksal zu kommentieren, aber die Augen des Inders zwingen uns, stumm zu bleiben. Im Gegensatz zu seiner Gefährtin, die ihren ganzen Haß mit einem Schlag offenbart, ist er imstande, wie ein Rheostat die Intensität seines Blicks nach Belieben zu steigern. Und mein Vergleich stimmtnur zur Hälfte, denn auch der Ausdruck seines Blicks verändert sich mit der Intensität.
»Ich kenne die Geheimnisse des BODENS nicht«, sagt der Inder, »und ich weiß deshalb nicht, wohin er Sie bringen will.«
»Nach Madrapour doch wohl«, sagt Caramans.
Caramans ist bleich, wie ich vermutlich auch, wie wir alle außer Pacaud mit seinem puterroten Schädel. Aber in seinem Äußeren ist er immer noch untadelig – ordentlich frisiert, korrekte Krawatte – und zieht auch weiter seinen Flunsch.
»Ich bin in Bhutan geboren, mein Verehrtester«, sagt der Inder. »Ich bin also durchaus berufen, Ihnen zu sagen, daß es östlich von Bhutan nicht die Spur eines Staates gibt, der sich Madrapour nennt. Madrapour ist das Produkt der blühenden Phantasie eines Witzboldes. Es gibt keine PRM. In diesem Gebiet gibt es auch kein Erdöl. Ebensowenig ein Vier-Sterne-Hotel am Ufer eines Sees, was mir für die Damen außerordentlich leid tut.«
Am meisten leid tut es indes den Damen selber. So absurd es klingen mag, der Verlust ihres Vier-Sterne-Hotels scheint ihnen näherzugehen als der Verlust des Staates, in dem sich das Hotel befinden sollte.
Ich erkenne an den japanischen Augen von Mrs. Banister, daß die Aussicht, in einer Holzhütte zu schlafen und »sich in einem Tümpel zu waschen«, für sie plötzlich kein Gedankenspiel mehr ist und daß sie sich von diesem letzten Schlag viel härter getroffen fühlt als von der Flugzeugentführung.
»Aber das ist doch unmöglich!« sagt sie und sieht den Inder flehentlich an, ohne dabei zu versäumen, mit ihrem aristokratischen Charme aufzuwarten. »Solche Scherze treibt man nicht mit den Leuten! Das ist abscheulich! Was soll nun aus uns
Weitere Kostenlose Bücher