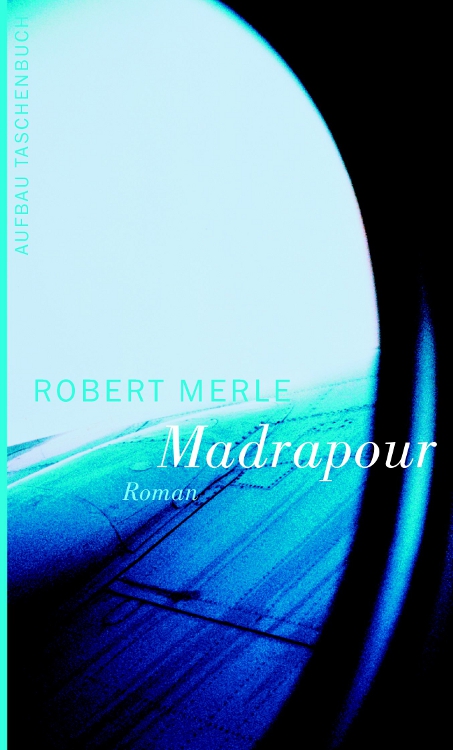![Madrapour - Merle, R: Madrapour]()
Madrapour - Merle, R: Madrapour
alle Ewigkeit in einem Ausdruck des Hasses erstarrt –, wenn nicht ihre glänzenden dunklen Augen unglücklicherweise so lebendig wären. Ich verspüre nicht die mindeste Lust, eine meiner Hände zu heben, um mich vielleicht an der Nase zu kratzen.
Ich streife die »Assistentin« nur mit einem kurzen Blick. Meine Augen kehren zu dem Inder zurück, gleichsam magnetisch von ihm angezogen. Mir ist das Wort »Opfergabe« im Ohr geblieben, und ich wundere mich im nachhinein, daß er ohne Ironie gesprochen hat. Meine Augen auf ihn gerichtet, hänge ich meinen Gedanken nach, als er plötzlich steht. Wie ich es sage. Und ich sage nicht, daß er aufsteht. Obwohl ich ihn nicht aus den Augen lasse, sehe ich keine Bewegung, keinen allmählichen Übergang von der sitzenden zur stehenden Position.
Ich sehe den Inder zuerst in seinem Sessel sitzen, dann aufrecht stehen, in der Hand den Revolver (der immer noch auf Blavatski gerichtet ist). Ohne jeglichen Übergang, ohne eine wahrnehmbare Zwischenstufe zwischen den beiden Positionen, so als ob ein Stück Film herausgeschnitten worden wäre. Die Wirkung auf mich ist schockierend, und noch schockierender wohl auf Blavatski, der sich immer noch im Schußfeld befindet. Ich habe den Eindruck, daß der Inder die Fähigkeit besitzt, sich nach Belieben in jedem Winkel des Flugzeugs zu materialisieren.
Als er seinen Rundgang beginnt, langsam und majestätisch, erwarte ich, daß er mit seiner Kollekte bei Chrestopoulos anfängt und dann bei Pacaud und Bouchoix einsammelt, entsprechend der Sitzordnung im rechten Halbkreis. Aber er geht an den ersten drei vorbei und bleibt hinter Blavatski stehen.
»Mr. Blavatski«, sagt er in sehr sachlichem Ton, während er ihm den Lauf seiner Waffe an den Nacken drückt, »hüten Sie sich, eine Bewegung zu machen, wenigstens bis ich den Revolver aus dem Futteral gezogen habe, den Sie auf der Brust tragen. Das wird Sie hindern, abenteuerliche Pläne gegen mich zu schmieden.«
Selbst im Angesicht des Todes sind wir auf die Ausplünderung nicht sonderlich vorbereitet. In unserem Kreis zeigen sich Unzufriedenheit, Bestürzung, Klagen, und es fließen sogar – beiden Frauen – Tränen. Man könnte meinen, daß man uns mit den mehr oder weniger wertvollen Gegenständen, die wir bei uns tragen, ein Teil von uns selbst wegnimmt.
Ich glaubte, über solches Besitzdenken erhaben zu sein. Ich irrte mich. Ich registriere den Verlust und empfinde ihn – was noch weniger normal ist – als einen Verlust an Persönlichkeit, als ich meine Armbanduhr in die Kunstledertasche des Inders lege; dabei ist die Uhr weder vom Material her noch als Erinnerung wertvoll.
Die Niedergeschlagenheit des Kreises ist um so größer, als der Inder zu jeder »Opfergabe« verächtliche Kommentare liefert, die allgemein im umgekehrten Verhältnis zum Wert des Schmuckstücks stehen. Zu meiner armseligen Armbanduhr sagt er nichts, hingegen bezeichnet er Mrs. Banisters Diamantenclips als »Kitsch«, Mrs. Boyds Ringe als »Ramsch« und Madame Edmondes schwere goldene Armreife als »Talmi«. Die abgenutzte, verschrammte, befleckte schwarze Kunstledertasche nachlässig in der Hand haltend, schüttelt er die Beute schonungslos durcheinander und behandelt unsere Reichtümer mit solcher Verachtung, daß man sich fragt, ob er sie nicht, wenn er uns verlassen hat, auf die Müllkippe werfen wird.
»Los, Mr. Chrestopoulos«, sagt er, als er schließlich zu dem Griechen kommt, »werfen Sie Ihren Klimperkram dahinein. Sie werden sich leichter fühlen. Letzten Endes haben Gold und Diamanten, die an sich nichts Besonderes sind, nur aus Konvention solchen Wert.«
Aber diese Bemerkungen trösten Chrestopoulos nicht. Man könnte meinen, daß er sich ein reichliches Pfund Fleisch von der Brust reißt, als er seine beiden goldenen Armbänder behutsam in die Tasche legt – sie hineinzuwerfen bringt er nicht über sich. Als schließlich der Ring mit dem großen Diamanten an der Reihe ist, den er an seinem kleinen Finger trägt, stöhnt er dumpf auf und sagt mit klagender Stimme: »Mein Finger ist dicker geworden. Der Ring geht nicht ab.«
»Ich rate Ihnen, Mr. Chrestopoulos, den Ring abzuziehen«, sagt der Inder streng. »Und zwar schnell. Sonst wird es meiner Assistentin ein Vergnügen sein, Ihnen den Finger abzuschneiden.«
Chrestopoulos unternimmt scheinbar verzweifelte Anstrengungen, um sich von dem Ring zu trennen. Ich sage »scheinbar«,denn ich bin nicht sicher, ob er sich echt bemüht. Und es
Weitere Kostenlose Bücher