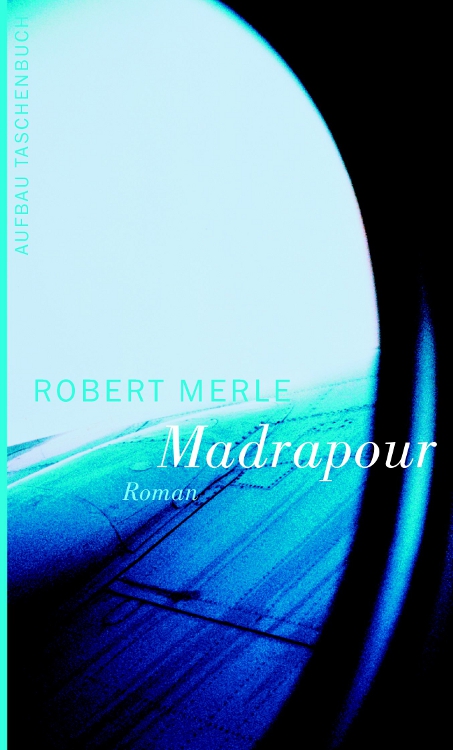![Madrapour - Merle, R: Madrapour]()
Madrapour - Merle, R: Madrapour
bedarf des Eingreifens der Stewardess, die mit Einverständnis des Inders aus der Pantry etwas geschmolzene Butter holt, damit der Ring schließlich abgeht. Nach meiner Ansicht war nicht ein Fettwulst das Hindernis, sondern die mehr oder weniger bewußte Verkrampfung des kleinen Fingers.
Nachdem dieses letzte Opfer vollbracht ist, sinkt Chrestopoulos mit einem verzweifelten Seufzer kraftlos in seinen Sessel zurück; Tränen rinnen über seine schlaffen Wangen. Wie ein in seinem Bau bedrohter Iltis verströmt er aus allen Poren einen widerlichen Gestank, der trotz der Entfernung bis zu mir dringt. Die leuchtend gelben Schuhe – der einzige Goldschimmer, der ihm geblieben ist – glänzen beinahe höhnisch an seinen Füßen.
»Ausgezeichnet, Mademoiselle«, sagt der Inder. »Werfen Sie noch das Glasperlenzeug hinein, und da Sie ohnehin auf den Beinen sind, gehen Sie bitte in die Pantry. Meine Assistentin wird Sie durchsuchen.«
Er selbst schleudert voller Widerwillen Blavatskis Revolver in die Tasche – und ich erwarte jeden Augenblick, daß irgendein Ring herausfällt, so abgenutzt und durchlöchert ist sie. Dann reicht er die Tasche seiner Assistentin und sagt ihr ein paar Worte in einer mir unbekannten Sprache. Die Inderin nickt und folgt der Stewardess in die Pantry.
Der Inder setzt sich dann mit eleganter, souveräner Bedächtigkeit wieder in seinen Sessel, schlägt die Beine übereinander und sieht uns mit einem leichten Seufzer an, als wäre er selbst von der Prüfung erschöpft, die er über uns hat ergehen lassen. Ich möchte ihn fragen, warum er es für nötig hält, die Stewardess zu durchsuchen, aber ich komme nicht dazu: sie taucht wieder auf, bleich und mit gesenkten Augen. Ich versuche, ihren Blick aufzufangen, aber zu meiner großen Enttäuschung verweigert sie erneut jeglichen Kontakt.
Als ich nun wissen will, wieviel Zeit uns noch bleibt bis zum Ablauf des Ultimatums, trifft es mich wie ein Schock: mein Handgelenk ist nackt und bloß. Und ich fühle mich auf eine völlig unangemessene Weise bestürzt, als ob der Inder mir mit der Uhr nicht einfach nur ein Meßinstrument weggenommen hätte, sondern das Gewebe, aus dem mein Leben zusammengefügt war.
In diesem Moment teilt sich der Vorhang zur Pantry, und die Inderin taucht wieder auf, in der Hand die alte schwarze Kunstledertasche, die mir jetzt viel dicker vorkommt.
Außerdem ist sie geschlossen. Die Inderin muß Mühe gehabt haben, den Reißverschluß zuzuziehen, denn das Kunstleder spannt sich. Ich frage mich, was sie wohl zu dem Schmuck und zu Blavatskis Revolver noch hineingesteckt haben mag, daß die Tasche einen solchen Umfang angenommen hat. Denn jetzt überschreitet sie die für Fluggepäck zulässige Norm bei weitem. Die Inderin stellt die Tasche nicht hin, sondern schleudert sie achtlos auf den Boden, so daß Chrestopoulos auffährt. Voll Kummer und Gier stiert er nach den vielen kleinen Rissen in der Tasche, als hoffte er, daß seine Ringe und Armbänder ihrem Gefängnis entweichen könnten, um zu ihrem Besitzer zurückzukehren. Eine vergebliche Hoffnung, denn die Beute des Inders befindet sich auf dem Boden der Tasche, und alles andere darüber ist zweifellos viel zu groß, um durch die schmalen Risse zu passen.
Die Inderin bezieht mit finsterem Blick und blinkendem Revolver hinter ihrem Sessel wieder ihren Posten.
Erneut breitet sich beklemmendes Schweigen aus. Der Inder sieht auf seine Uhr: Er ist jetzt der einzige an Bord, der das kann. Und wir alle sind so niedergedrückt durch den Verlust unserer Wertsachen, uns ist so bange vor dem, was die verrinnende Zeit bringen wird, daß keiner ihn zu fragen wagt, wie spät es ist.
Der Inder spürt das Ausmaß unserer Entmutigung und sagt herausfordernd: »Noch zwanzig Minuten.«
Wenn er mit dieser Bemerkung uns anspornen, uns aus der Apathie herausreißen wollte, ist es ihm vollauf gelungen.
»Darf ich Ihnen eine Frage stellen?« sagt Mrs. Banister mit überaus verführerischen Blicken und Gebärden.
»Bitte«, sagt der Inder.
»Ich halte Sie für einen sehr gebildeten Mann«, sagt sie mit schamloser und zugleich hochmütiger Koketterie – als ob sie sich zu Füßen des Inders wälzte –, aber würdevoll. »Wahrscheinlich sind Sie auch sehr sensibel (der Inder lächelt). Wie soll ich also glauben, daß Sie, Monsieur, in zwanzig Minuten einen von uns ermorden werden?«
»Ich werde es nicht selbst tun«, sagt der Inder mit gespieltemErnst. »Meine Assistentin wird es tun. Wie
Weitere Kostenlose Bücher