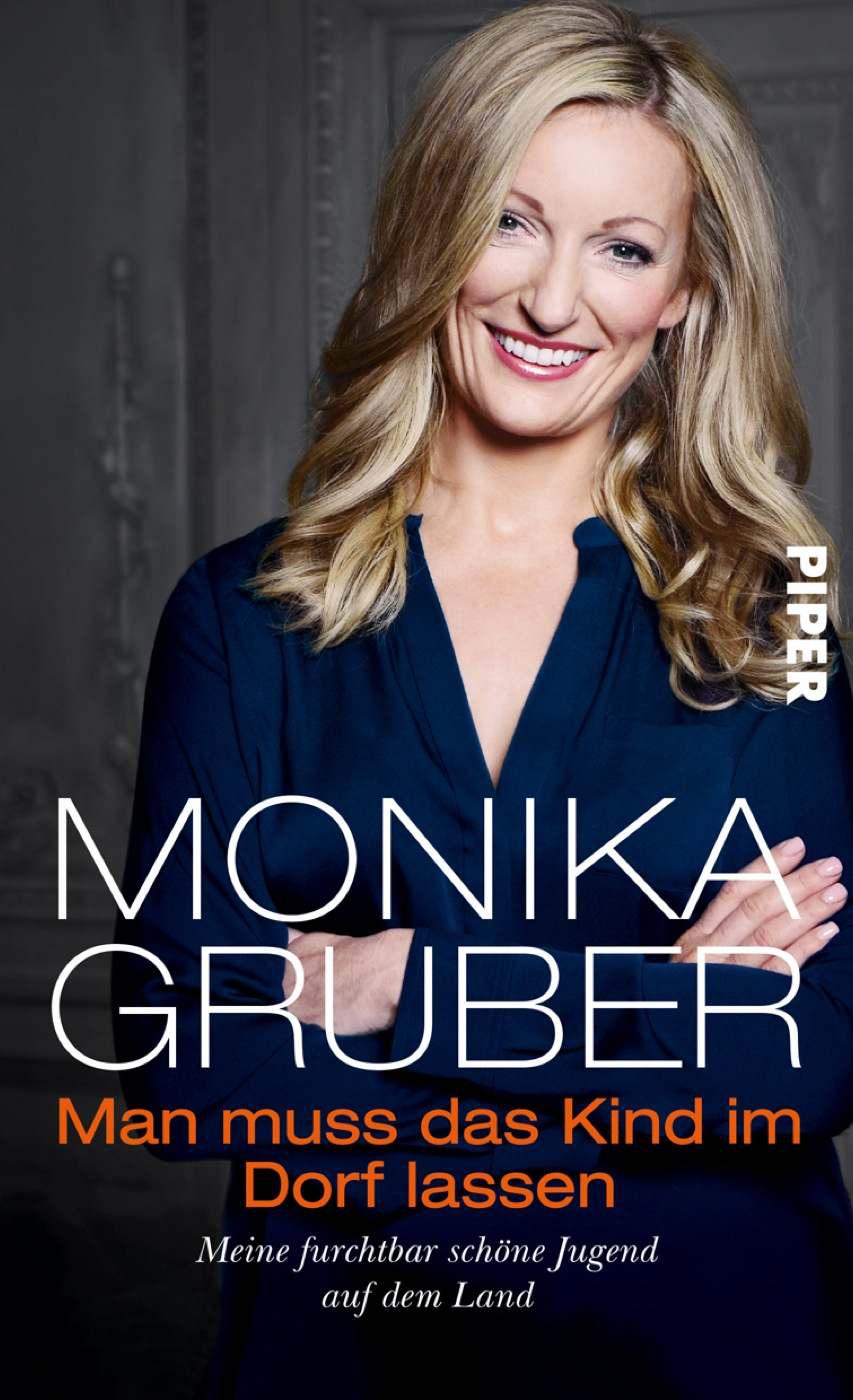![Man muss das Kind im Dorf lassen: Meine furchtbar schöne Jugend auf dem Land (German Edition)]()
Man muss das Kind im Dorf lassen: Meine furchtbar schöne Jugend auf dem Land (German Edition)
sie sich wunderten, dass das Häuschen unter dem Gehämmere und Gedresche vom »narrischen Königsederbuam« nicht auseinanderbrach.
Im Sommer bekam der Koni oft Besuch von seinen Spezln, und sie saßen dann in der Einfahrt auf einer Bierbank und begutachteten ihre Mopeds und später ihre Autos. Der Koni hatte sich ein ganz ausgefallenes Gefährt hergerichtet: einen tiefer gelegten Opel Manta in Schwarz, bei dem die Kühlerhaube und die Seitentüren mit gelben und roten Flammen bemalt waren, in dem ich aber nie mitgefahren bin, weil ja die Freundin vom Koni immer mitfuhr. Ich hatte sie zwar nie gesehen, aber sie war anscheinend Krankenschwester und lebte in München, und der Koni besuchte sie jede Woche. Ich erinnere mich noch, dass ich ein bisschen eifersüchtig war, denn schließlich war es ja mein Koni, und ich kannte ihn schon vor dieser Schwesterntussi.
Ab und zu schlich ich mich abends zum Haus der Familie Franz, deren Garten direkt an den Garten der Königseders angrenzte, und durch die Hecke konnte ich den Koni und den Sepp mit ihren Freunden beobachten. Das meiste ihrer Gespräche über Mopeds und Autos und natürlich über Mädels habe ich nicht verstanden, aber ich fand sie alle damals furchtbar cool: den Glück Franze, die Daschinger-Brüder und wie sie alle hießen.
Eines Morgens – ich muss etwa in der neunten Klasse gewesen sein, denn ich hatte nachmittags als Wahlfach Stenografie bei Frau Schuholz – mussten wir mit dem Schulbus auf dem Weg nach Erding plötzlich einen Umweg von der Hauptstraße über einen Feldweg nehmen. Als der Bus über die holprige Straße zuckelte, schauten wir alle aus dem Fenster, um herauszufinden, was die Ursache für diese außerplanmäßige Umleitung war. Und da sah ich sie am Straßenrand stehen – nie werde ich diesen Moment vergessen –: Konis schwarzer A-Manta mit den Feuerzungen stand völlig demoliert etwas abseits der Hauptstraße, und das Herz blieb mir fast stehen, als ich bemerkte, dass die komplette Heckscheibe voller Blutspritzer war. Ich war mir sicher, dass etwas Schreckliches passiert war. Ich konnte mich den ganzen Tag kaum auf den Unterricht konzentrieren, und dann hatte ich auch noch nachmittags den verfluchten Stenographie-Unterricht, also musste ich bis um achtzehn Uhr warten, als meine Mutter mich von der Schule abholte und mir mit tränenerstickter Stimme erzählte, was ich im Innersten schon wusste: Koni war tot. Mein Koni. Beim Schreiben dieser Zeilen stehen mir die Tränen in den Augen. So jung. So voller Lebenshunger. Immer gut gelaunt. Selbst seine Augen lächelten immer. Das ganze Leben noch vor sich. Aus. Vorbei. Zu Ende. Unfassbar, unbegreiflich. Ich weinte die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag.
Die Beerdigung war eines der schrecklichsten Erlebnisse, die ich je hatte. Alle auf dem Friedhof waren zutiefst erschüttert, und alle weinten, auch die Männer. Jeder einzelne Dorfbewohner hätte sicherlich viel darum gegeben, noch einmal abends zu hören, wie der Koni auf sein Schlagzeug eindrosch. Und alle werden wir uns immer erinnern an den lustigen Burschen mit seinem roten Haarschopf und den vielen Sommersprossen, den blauen Augen, aus denen der Schalk blitzte, und der immer ein leicht schiefes Lächeln auf den Lippen hatte.
Erster Schultag
Bereits an meinem ersten Schultag am Gymnasium Erding war mir klar: Ich war anders als die anderen. Wenn man das als erwachsener Mensch von sich behauptet, klingt das ja durchaus wie ein kleines Kompliment an sich selber, als zehnjähriges Kind jedoch wünscht man sich in erster Linie eines: Man möchte genauso sein und vor allem genauso ausschauen wie alle anderen. Zur Gruppe gehören. Aber schon bei der ersten groben Durchsicht (auf Bayerisch: Abchecken) meiner Mitschüler stieg leichte Panik in mir hoch: Wie sollte ich wohl jemals zur Gruppe dieser feschen Stadtkinder gehören, die da im Klassenzimmer versammelt waren? Bereits in den ersten drei Minuten war mir klar, dass keines dieser Kinder vom Bauernhof stammen konnte, denn sie hatten alles, was ich auch gern gehabt hätte: einen passablen Haarschnitt, Klamotten von damals sehr begehrten Marken wie Benetton, Lacoste oder Chiemsee und bunte, leichte Nylonschulranzen von Scout. Das Ganze war garniert mit einem Rest Adriabräune vom gerade zwei Wochen zurückliegenden Italienurlaub. Und all diese gut gebräunten, gut gekleideten Kinder wurden von ihren ebenfalls braun gebrannten mittelständischen Unternehmereltern zur Schule begleitet.
Weitere Kostenlose Bücher