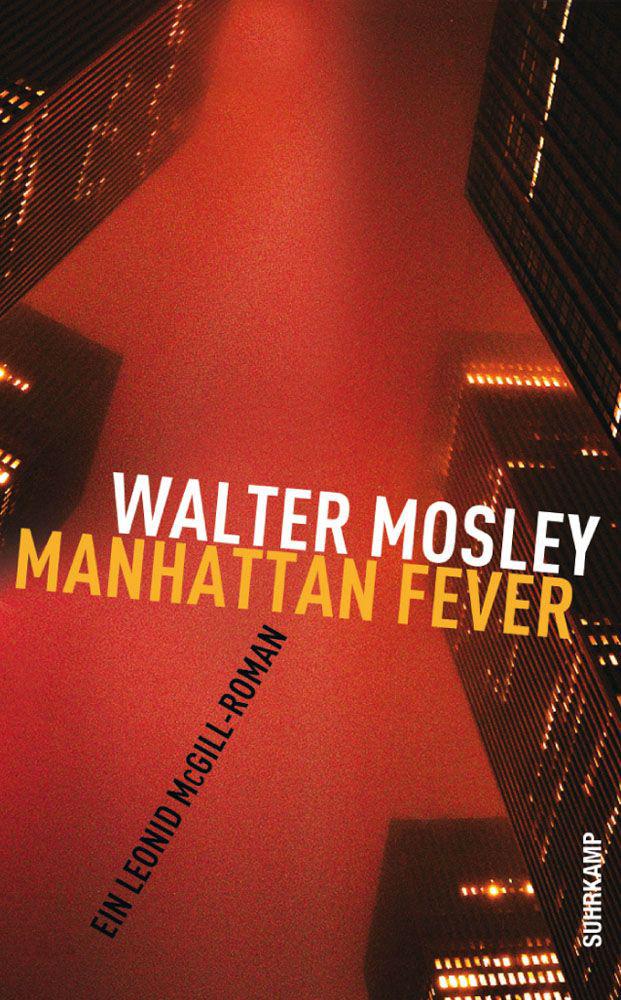![Manhattan Fever: Ein Leonid-McGill-Roman (suhrkamp taschenbuch) (German Edition)]()
Manhattan Fever: Ein Leonid-McGill-Roman (suhrkamp taschenbuch) (German Edition)
angerufen. Er, ähm, wird sich höchstwahrscheinlich als nützlich erweisen.«
»Es ist eine vertrauliche Angelegenheit.«
Ich nickte, verkniff es mir jedoch, mein Temperament oder mein Fieber zu zeigen.
Das Hausmädchen betrat das Zimmer, in den Händen ein Tablett mit zwei Gläsern Wasser, gefolgt von der drastisch verwandelten Velvet Reyes. Die junge heroinsüchtige Prostituierte trug ein weites geblümtes Kleid, ihr langes schwarzes Haar war auf dem Hinterkopf zu einem Knoten gebunden. Hinter Velvet kam ein junges Mädchen von vielleicht drei Jahren herein. Das Kind hatte große schwarze Augen, mit denen es mich eindringlich ansah. Seine Mutter musterte meinen Sohn.
»Das ist Adonia«, stellte Shelby das Hausmädchen vor, »ihre Tochter Velvet, und ihre Enkeltochter Minolita.«
»Hallo«, sagte ich.
»Hi«, sagte das Mädchen und lächelte.
»Habe ich Sie schon mal irgendwo getroffen?«, fragte mich Velvet.
Die Frage ließ Adonias Blick in meine Richtung schwenken.
»Ich glaube nicht«, sagte ich. »Ich würde mich bestimmt an Sie erinnern.«
Adonia stellte unsere Gläser auf dem unbezahlbaren Gemälde ab und scheuchte ihre Brut aus dem Zimmer. Ich ergriff mein Glas, während Twill Wort hielt und seins unangerührt ließ.
Nach dem Abgang der Dienerschaft entstand ein kurzes Schweigen. Shelby war leicht verstimmt über Twills (alias Mathers’) Anwesenheit.
»Wir wurden sehr kurzfristig hierhergebeten, Mr. Mycroft«, sagte ich. »Ich habe noch andere Termine.«
Mein Ton gefiel ihm nicht. Das war in Ordnung – ich mochte seinen Türsteher nicht.
»Mein … unser Sohn Kent studiert Politikwissenschaft an der NYU «, sagte er. »Er ist dreiundzwanzig, aber jung für sein Alter. Vor Kurzem sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, dass er in ziemlich raue Gesellschaft geraten ist. Wir machen uns Sorgen, dass er Ärger bekommen könnte.«
»Was für Ärger?«
»Nun … das wissen wir nicht genau.«
»Vielleicht stimmt das, was Sie gehört haben, gar nicht«, sagte ich, »oder ist übertrieben.«
»Nein«, sagte Shelby.
»Woher wissen Sie das?«
»Jemand, der ihn von der Uni kennt, hat uns alarmiert. Jemand, dem wir vertrauen.«
»Und wer ist das?«
»Welche Rolle spielt es, wer es uns erzählt hat? Ich sage es Ihnen.«
In diesem Augenblick schlug das Aspirin an. Das Fieber ließ nach, und es war, als ob ich mir plötzlich meiner Umgebung bewusst wurde. Ich stand auf.
»Wir gehen«, sagte ich zu Twill.
Er stand ebenfalls auf.
»Ich, ich, ich verstehe nicht«, sagte Mr. Shelby Mycroft und stand nun auch.
»Hören Sie, Mann«, erklärte ich ihm. »Ich bin nur hier, weil Breland mich darum gebeten hat. Sie haben ein Problem, und ich will Ihnen helfen. Aber wenn Sie nicht alles, was Sie wissen, auf den Tisch legen wollen, habe ich dafür keine Zeit.«
»Ich habe Ihnen erzählt, was Sie wissen müssen.«
»Komm«, sagte ich zu Twill.
»Es ist unsere Tochter, Mr. McGill«, sagte Sylvia Mycroft. »Sie ist diejenige, die es uns erzählt hat.«
Shelby stand da und schaffte es irgendwie, mich und seine Frau gleichzeitig wütend anzusehen.
»Und was genau hat Ihre Tochter gesagt?«, fragte ich.
»Was ich Ihnen bereits erzählt habe«, erwiderte Shelby barsch.
»Ich werde es von ihr hören müssen.«
»Nein.«
»Dann kann ich Ihnen nicht helfen.«
»Ich bin derjenige, der Sie bezahlt, Mr. McGill.«
»Nicht, wenn ich den Job nicht annehme«, sagte ich und blickte in seine dunkler werdenden Augen.
»Shelby«, sagte Sylvia und starrte sein Profil an.
17
Twill und ich saßen erneut allein mit dem Rücken zum Fluss in dem großen sonnigen Zimmer. Wir sprachen nicht, weil es nichts zu sagen gab. Ich übte meinen Beruf aus, und Twill lernte, was es zu lernen gab. Reichtum beeindruckte ihn nicht in dem Maße wie mich. Obwohl er bereits im Alter von vierzehn ein Meisterdieb gewesen war, begehrte er das Geld oder die Dinge, die man damit kaufen konnte, eigentlich nicht. Twill, der Sohn meines Herzens, war ein Kind der Moderne. Für ihn war Geld eine vorgefundene natürliche Ressource wie Wind – oder getrockneter Dung.
Die kleine Minolita tauchte in einer Tür auf, einer anderen als der, durch die wir gekommen waren. Sie starrte mich an und bohrte sich dabei in der Nase.
»Komm her, du kleines Ding«, sagte ich und hielt ihr meine Boxerpranken hin.
Sie öffnete den Mund, schluckte viel Luft und rannte dann auf mich zu wie ein glückliches Hündchen, das gerade einen unbewachten Teller entdeckt
Weitere Kostenlose Bücher