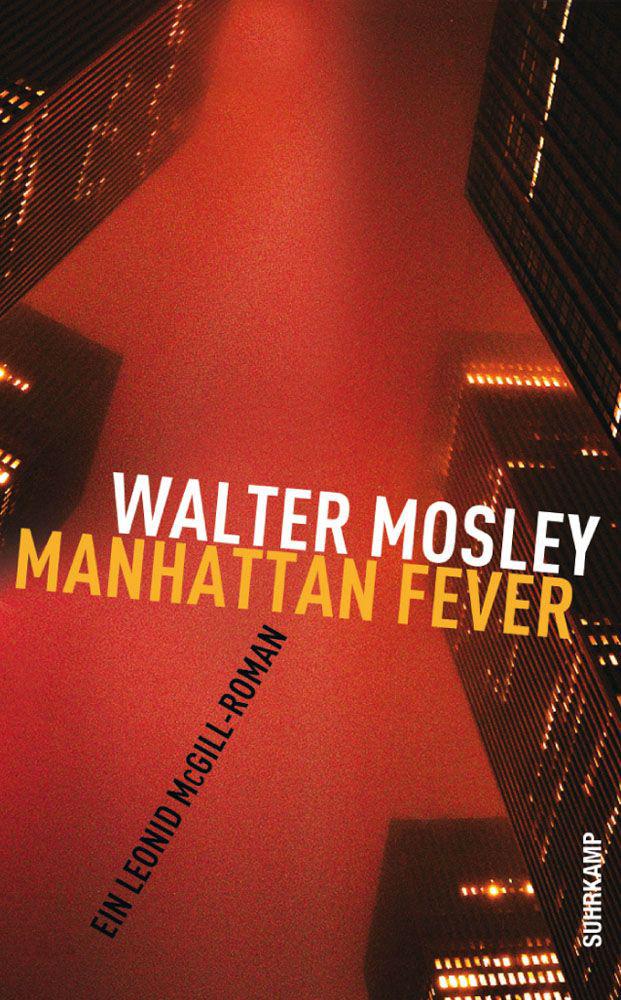![Manhattan Fever: Ein Leonid-McGill-Roman (suhrkamp taschenbuch) (German Edition)]()
Manhattan Fever: Ein Leonid-McGill-Roman (suhrkamp taschenbuch) (German Edition)
ausgesprochen von einer Frau, die gestorben war, ehe er auf die schiefe Bahn geriet.
»Ich hab mich überall umgehört, LT «, sagte er. »War nicht allzu schwer, denn ich hatte ja einen Namen. Gestern Abend hab ich auf einer Lesung eine Frau getroffen, die Morgan kennt, Tourquois Wynn. Tourquoiswar früher Lehrbeauftragte für Kreatives Schreiben am Hunter College. Dort hatte sie vor fünf Jahren einen schwarzen Studenten namens William Williams. Er hat ihr Schreibseminar besucht.«
Ein kalter Schauder, der durch die Räume strömte, in denen zuvor tagelang das Fieber gehaust hatte, ließ mich beinahe zittern. Ich wog mehrere unangemessene Reaktionen gegeneinander ab: Erstens dachte ich daran, Lemon mit einem rechten Schwinger k. o. zu schlagen; zweitens hätte ich abhauen und die Straße hinunterrennen können, dorthin zurück, wo es keine Antworten auf nicht zu beantwortende Fragen gab; und drittens erwog ich, mir die Ohren zuzuhalten und »Nah, na, na, naa, na, na, na, naaa, na na, na, na, na, na« zu singen.
»Ist diese Tourquois noch am Hunter College?«, fragte ich. Ich sprach den Namen aus wie er – Tur-kwa.
»Nein. Nachdem ihr erster Gedichtband den Sanders-Preis gewonnen hat, hat sie eine Professur an der NYU angenommen. Sie hat gesagt, Williams hätte ihr erzählt, er habe sich nach einem Schriftsteller benannt, weil ihn seine Zeit als politischer Aktivist so zermürbt hätte, bis er nur noch das Spiegelbild von etwas gewesen sei. Er habe gesagt, wenn ein Mann bloß noch ein Spiegelbild ist, sei Schreiben das Ehrlichste, was er tun könne.«
Diese schlichte Erklärung belegte, dass der Mann in dem Schreibseminar mein Vater war, Clarence Tolstoy William Williams McGill. Daran hatte ich keinen Zweifel. Ich musste die Hände falten, damit sie nicht zitterten.
»Weiß sie, wie man ihn erreichen kann?«
»Sie hat gesagt, sie hätte seit dem Seminar vor fünf Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich hab ihr geglaubt. Aber Morgan und ich haben uns für morgen um sieben im Nook Petit in der 7 th Avenue mit ihr zu einem frühen Abendessen verabredet. Du könntest auch kommen. Vielleicht hast du eine Frage, die sie beantworten kann.«
»Warum machst du das, Lemon?«, wollte ich wissen. Es war eine instinktive Frage, so wie ein rechter Cross nach einem linken Haken auf den Körper.
»Eine Gefälligkeit.«
»Ich dachte, du wolltest meiner Welt den Rücken kehren.«
»Stimmt. Ich halt mich von der Szene fern. Aber jeder sagt, dass du nichts mehr mit Gangstern zu tun hast, LT . Und selbst wenn, ein Typ wie ich braucht vielleicht irgendwann mal einen Freund.«
»Irgendwann mal ist okay, aber wie viel willst du sofort?«
»Gar nichts, Mann. Ich will nur, dass du nicht vergisst, dass du es von mir hast.«
32
Ich habe das West Village immer gemocht, in all seinen Inkarnationen. Als ich ein kleiner Junge war, war es ein Ödland mit Fabriken und alten Italienern, dem Meatpacking District und vielleicht ein paar Privathäusern. Im Laufe der Zeit waren angehende Künstler, aufstrebende Models und Prostituierte (verschiedenen Geschlechts) in die Gegend gezogen. Es gab Late-Night-Jazz-Clubs, in denen sich die Musiker manchmal nach ihren Uptown-Gigs blicken ließen.
Damals war es noch kein Touristenziel mit überteuerten Boutiquen und großen Hotels, man musste sich seinen Weg nicht zwischen Massen von Touristen und Investment-Bankern hindurch bahnen, die jedes Gebäude in einen Komplex aus Eine-Million-Dollar-Wohnungen mit Rigips-Wänden und Einzimmerapartments für siebentausend Dollar im Monat umwandelten.
Das West Village hatte sich verändert und noch mal verändert, doch es hatte immer noch Charme. Nach einem kleinen Spaziergang setzte ich mich vor ein Café in der Hudson Street, südlich der Christopher Street. Ich bestellte Milchkaffee und Mandel-Biscotti und wartete auf Inspiration.
Ich vermisste das alte West Village. Und ich vermisste mein Fieber. Beide kamen mir wie längst vergangen vor – Orte, an denen ich mich früher hatte verstecken können.
»Hallo?«, meldete sie sich.
»Ich bin’s.«
»Mr. McGill?«
»Ja.«
»Stimmt irgendwas nicht?«, fragte Zella Grisham.
»Nein. Ich sitze bloß in einem Straßencafé und warte darauf, eine Freundin meines Vaters zu treffen.«
»Oh. Und warum rufen Sie dann an?«
»Dies und das. Ich hab vielleicht eine Verbindung zu den Leuten, die Ihre Tochter adoptiert haben. Ich werde mich in den nächsten Tagen mit ihnen in Verbindung setzen und ihnen
Weitere Kostenlose Bücher