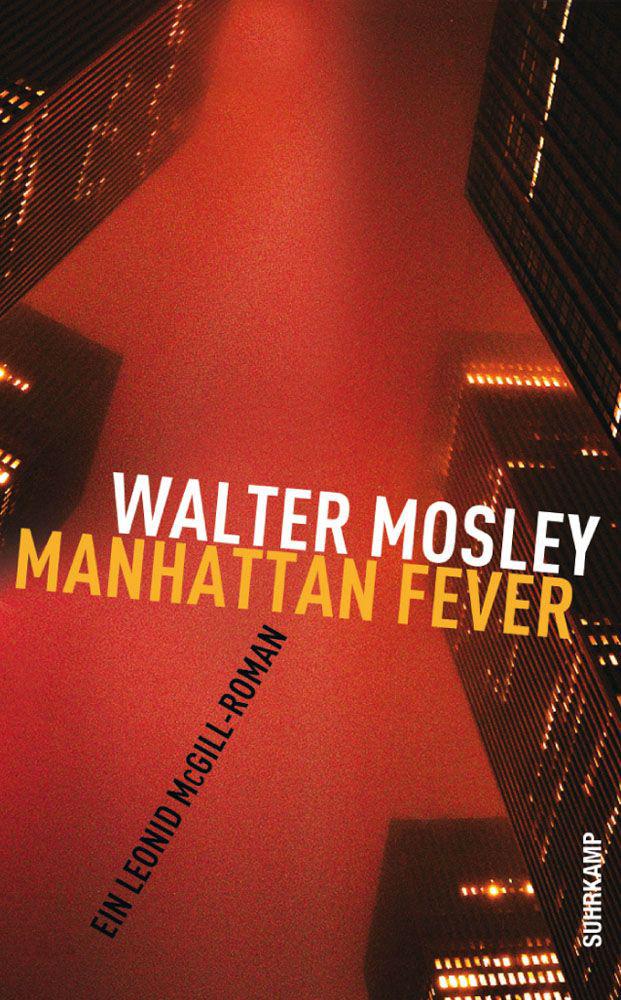![Manhattan Fever: Ein Leonid-McGill-Roman (suhrkamp taschenbuch) (German Edition)]()
Manhattan Fever: Ein Leonid-McGill-Roman (suhrkamp taschenbuch) (German Edition)
war schon ein wenig zurückgewichen, trotzdem schätzte ich ihn auf höchstens dreißig. Ich fesselte ihn mit einer Nylonschnur an einen Esszimmerstuhl.
Meine Hände zitterten vom Adrenalinschub des Kampfes. Ich nahm eine der Tabletten, die Dr. Bancroft mir gegeben hatte, und setzte mich vor den bewusstlosen Killer, während in meinem Kopf und meinem Herzen langsam wieder die Logik einer höflichen Gesellschaft Einzug hielt.
Der Übergang war wie in einem dieser alten Schwarz-Weiß-Filme, in denen sich Mr. Hyde allmählich wieder in Dr. Jekyll verwandelt. In meinem Fall fand die körperliche Verwandlung allerdings nur innerlich statt. Der Mörder in meiner Brust ließ nach und nach von mir ab und seine menschliche Hülle erschöpft und entkräftet an den Ufern der Zivilisation zurück.
Der verhinderte und vollendete Killer war immer noch bewusstlos. Ich zückte mein Handy, rief eine Nummer auf, die ich vor nicht allzu langer Zeit angerufen hatte, und drückte auf Verbinden. Nachdem ich so wenige Worte wie möglich verloren hatte, beendete ichdas Gespräch, nahm wieder auf dem Stuhl Platz und fragte mich, was für ein Narr es im Dunkeln mit einem unbekannten Feind aufnimmt, ohne eine Waffe oder einen Freund als Verstärkung.
Es hätten auch zwei oder mehr Killer auf die Quick-Familie angesetzt werden können. Wie wäre es mir gegen eine mögliche Überzahl ergangen? Die Antwort auf diese Frage war leicht. Ich hatte bereits zwei Männer getötet, und auch wenn diese Tat tief in meinem Herzen auf eine hässliche Art befriedigend gewesen war, hatte sie mir bei der Lösung meiner Probleme und der meiner Klientin nicht weitergeholfen. Außerdem, hätte ich eine Waffe auf den Killer gerichtet, hätte er sich wahrscheinlich auf seine Reflexe verlassen, statt kapitulierend die Hände zu heben – das jedenfalls hätte ich gemacht.
Als ich aufblickte, sah ich, dass er die Augen geöffnet hatte. Er hatte einen Bluterguss am Kinn, und sein linkes Auge war beinahe zugeschwollen, aber er beschwerte sich nicht. Er starrte mich schräg von der Seite an und versuchte erfolglos, mich einzuschüchtern. Ich erwog, ihn zu töten, entschied jedoch, noch ein kleines bisschen zu warten.
Um 3.44 Uhr dachte ich über den Anruf nach, den ich verpasst hatte – der unbekannte Anrufer hatte keine Nachricht hinterlassen. Wenn es sich nicht um einen Notfall gehandelt hatte, war es ziemlich spät für einen Anruf gewesen. Ich machte mir Sorgen, dass ich etwas Wichtiges verpasst hatte. Genau in diesem Moment läutete es. Der Killer blickte aufmerksam auf. Ich zuckte die Achseln und stapfte zur Haustür.
Der Übergang von dem dunkelblauen Kleid zu ihrerdunklen Haut war fast nicht zu erkennen. Dazu trug sie korallenfarbenen Lippenstift. Das Make-up war wahrscheinlich die größte Überraschung dieser Nacht.
»Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, Sie suchen nach Vorwänden, mich anzurufen«, waren Antoinette Lowrys erste Worte.
»Ich sehe Sie gern«, gab ich zu. »Aber nur weil ich mir, wenn Sie vor mir stehen, keine Sorgen machen muss, was Sie hinter meinem Rücken treiben.«
Sie lächelte und sagte mit diesem flüchtigen Ausdruck der Belustigung, dass ich, möglicherweise, der erste schwarze Mann seit sehr langer Zeit war, den sie eventuell eines zweiten Blickes würdigen würde.
»Kommen Sie rein«, sagte ich. »Ich muss Ihnen was zeigen.«
Ich führte sie ins Wohnzimmer. Sie blieb neben mir stehen und betrachtete mein menschliches Paket ohne jede Überraschung.
»Wer ist das?«, fragte sie.
Ich setzte zu einer langen Erklärung an, wie ich in dieses kleine Haus in Queens gekommen war. Ich erwähnte Minnie und Harry mit sämtlichen Namen und auch Johann Brighton. Ich sprach über Bingo und seine toten Männer und über meine Überzeugung, dass die Todesliste um eine ursprünglich unschuldige dreiköpfige Familie erweitert worden war.
» Parlez-vous français? «, fragte sie den Gefangenen.
Er nickte und warf mir einen Blick zu. Ich gab mir alle Mühe, möglichst blöd und rüpelhaft rüberzukommen, zumal Antoinette den Mann nicht zuerst gefragt hatte, ob er englisch sprach.
Sie griff in ihre Nylontasche und zog einen ziemlich großen Totschläger heraus. Den zeigte sie dem Killer, die beiden kamen zu einem stillschweigenden Einverständnis, und sie riss ihm das Klebeband vom Mund.
»Was machen Sie hier?«, fragte sie ihn auf Französisch. Dem Akzent nach hätte sie auch eine Pariserin sein können.
» Rien «,
Weitere Kostenlose Bücher