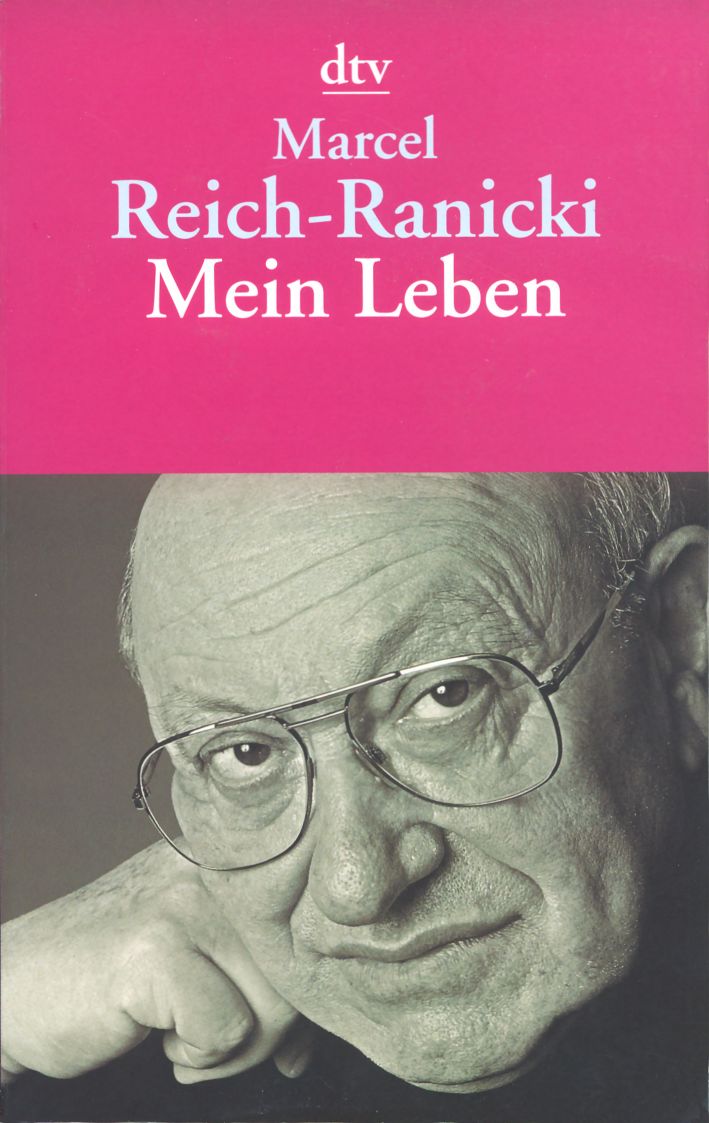![Mein Leben]()
Mein Leben
etwa das Bedürfnis, mich an der deutschen Not zu laben? Nein, keineswegs. Nicht Rachsucht trieb mich nach Berlin, sondern Sehnsucht: Die Stadt wollte ich wiedersehen, in der ich aufgewachsen war, den Ort, der mich geprägt hatte.
Der Plan des Auslands-Nachrichtendiensts war einfach: In Berlin funktionierte bereits eine Polnische Militärmission. Dort sollte ich arbeiten, und zwar in der Abteilung für Rückforderungen und Entschädigungen. Diese Instanz hatte den Standort der aus Polen während des Krieges abtransportierten Maschinen und Fabrikeinrichtungen zu ermitteln und dann deren Rückgabe zu beanspruchen.
Gleichzeitig sollte ich für den Nachrichtendienst, den Geheimdienst, tätig sein.
Über meine Aufgabe in der Militärmission würde man mich an Ort und Stelle unterrichten. Was aber sollte ich für den Geheimdienst machen? Der Major tat sehr geheimnisvoll. Darüber könne man jetzt nicht reden, er murmelte etwas von zahllosen Nazis, von Nachfolge-Organisationen, deren Aktivitäten sich auch auf die jetzt an Polen gefallenen Gebiete erstreckten. Vorerst solle ich mich in Berlin gut umsehen, später würde ich dort schon die nötigen Weisungen erhalten. Auf welchem Wege? Das würde ich schon merken – sagte der Major unwirsch; und dann etwas höflicher: Im Geheimdienst müsse man Geduld haben. Ich begriff, daß ich nicht zu viele Fragen stellen sollte, und ich bereitete mich auf die Reise vor. Tosia konnte nicht mitfahren, jedenfalls nicht gleich.
Als ich im Januar 1946 zusammen mit drei anderen Angestellten der Militärmission mit einem Auto gegen Abend in das ganz dunkle, das zerstörte, das so trostlose Berlin kam, hatte ich schon allen Anlaß, Schadenfreude, ja, tödlichen Haß zu empfinden. Aber davon konnte keine Rede sein, ich war zum Haß nicht imstande – und ein klein wenig wundert mich das noch heute. Bedarf es vielleicht einer Rechtfertigung? Trotz allem war mir Haß immer schon fremd, und er ist mir fremd geblieben. Ich kann mich furchtbar aufregen, erhitzen und ereifern, ich kann aus der Haut fahren und in Harnisch geraten. Aber richtig hassen, gar längere Zeit hassen – nein, das konnte ich nie, das kann ich auch heute nicht. Ich weiß, daß es keinen Grund gibt, darauf stolz zu sein. Und was auch in meinem Leben geschehen ist, welches Unrecht mir auch angetan wurde, ich habe niemals einen Menschen, der sich mit mir versöhnen wollte, zurückgewiesen. Das Gegenteil hat sich leider oft ereignet.
In der Militärmission hatte ich sehr wenig zu tun, der Geheimdienst ließ mich in Ruhe: Von ihm kamen keinerlei Weisungen – was mich mit der Zeit immer mehr wunderte und immer weniger betrübte. Denn da gab es etwas, was meine Freizeit, über die ich reichlich verfügte, ganz und gar in Anspruch nahm: Berlin. Ich wollte sie sehen: die Häuser, in denen ich gewohnt, die Schulen, die ich besucht, die Theater, die ich geliebt hatte. Ich war auf der Suche nach meiner verlorenen Jugend, der herrlichen und der schrecklichen.
Ich stand vor dem Gebäude, das ich einst für das schönste in der ganzen Stadt gehalten und das den Mittelpunkt meines Lebens gebildet hatte: vor dem zerstörten Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Es war ein diesiger, ein regnerischer Tag. Niemand ließ sich vor dem Theater blicken, ich war ganz allein. Plötzlich spürte ich, daß meine Augen feucht wurden, daß Tränen über meine Backen liefen. Doch es war nicht der durch die Ruinen wehende, der schneidende stürmische Wind, der diese Tränen verschuldete. Meine Jugend war es wohl, der ich hier, auf diesem kalten und leeren Berliner Platz, verschämt nachweinte. Ich ging zum Bahnhof Friedrichstraße, erst langsam und dann immer schneller, als wollte ich mich von der Sentimentalität befreien.
Die Abende verbrachte ich im Theater, das noch oft in provisorischen Sälen spielte, oder in Konzerten der Berliner Philharmoniker, an deren Spitze jetzt ein beinahe unbekannter, ein vorzüglicher junger Dirigent stand: Sergiu Celibidache. Von allen Theateraufführungen hat sich in meinem Gedächtnis am stärksten Lessings »Nathan« eingeprägt. Für mich war es ein ungewöhnlicher Abend. Das Stück, das im »Dritten Reich« nicht gespielt werden durfte, sah ich zum ersten Mal in meinem Leben. Paul Wegener, ein vor dem Krieg berühmter Mime, war sichtlich bemüht, in der Figur des weisen Nathan alles Jüdische, etwa im Tonfall oder in der Gestik, zu vermeiden. Offenbar befürchtete er, man hätte es als Antisemitismus mißverstehen
Weitere Kostenlose Bücher