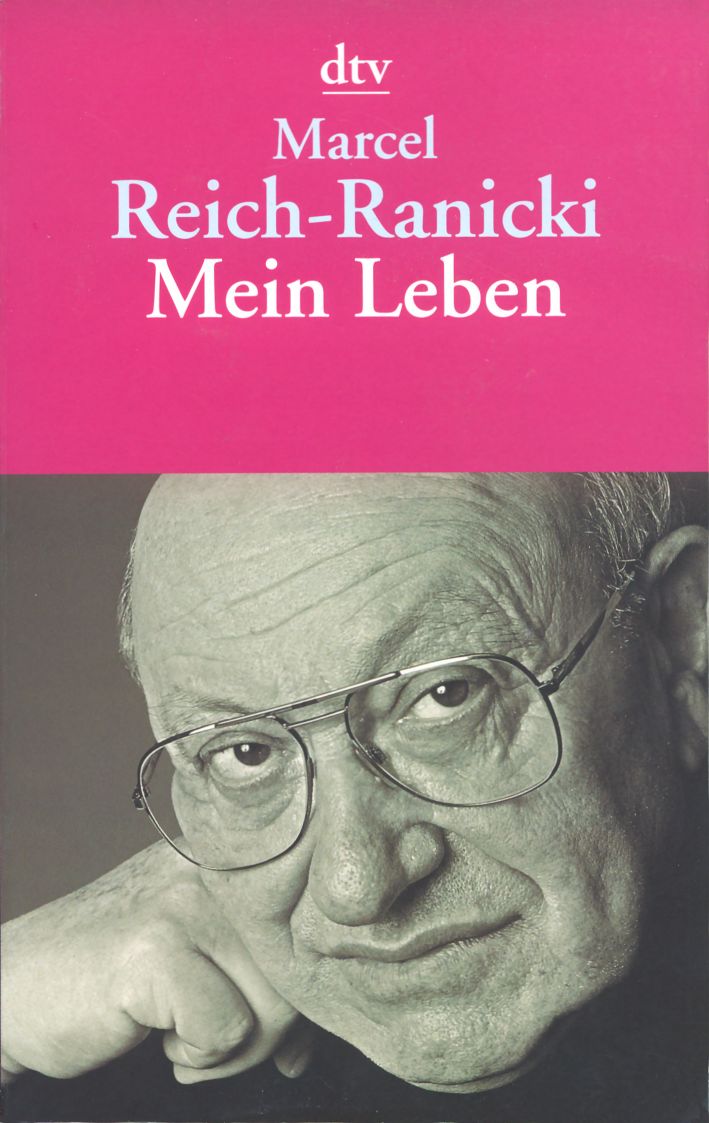![Mein Leben]()
Mein Leben
Frage meiner Mutter, ob sie heute noch wiederkommen würden, verneinten sie entschieden. Tatsächlich kamen sie nicht wieder.
Wenige Tage später erfuhren wir den Hintergrund. Einem jungen Polen jüdischer Herkunft, der an mehreren erfolgreichen Aktionen einer patriotischen Widerstandsorganisation teilgenommen hatte, war es auf abenteuerliche Weise gelungen, aus dem Warschauer Gestapo-Gefängnis zu fliehen. Daraufhin wurden über hundert Personen – sowohl Juden als auch Nichtjuden – als Geiseln genommen, und zwar ausschließlich Akademiker: Rechtsanwälte und Ingenieure, Ärzte und Zahnärzte. Auf dieser Liste stand auch der Name meines Bruders.
War der Gesuchte in seiner Wohnung nicht anzutreffen, dann hat man in der Regel als Ersatzperson einen beliebigen sich dort aufhaltenden Mann mitgenommen: ein Familienmitglied oder einen Besucher oder einen Handwerker, der hier gerade etwas reparierte. Alle im Rahmen dieser Aktion verhafteten Personen wurden hingerichtet. Mein Bruder indes blieb verschont: Ein kleines, Ball spielendes Mädchen hatte ihm das Leben gerettet.
Warum wurde ich nicht, wie das in den meisten anderen Fällen geschehen war, an Stelle meines Bruders verhaftet und ermordet? Eine vernünftige Frage – so will es scheinen. Dennoch ist sie absurd, und sie war auch nur am Anfang der Okkupationszeit denkbar, als wir die Besatzungsmacht und ihre Methoden noch nicht hinreichend kannten, als wir noch nicht wußten, daß die Deutschen, die unser Geschick in ihren Händen hatten, nahezu alle unberechenbare Wesen waren, fähig zu jeder Gemeinheit, jedem Frevel, jeder Untat. Noch hatten wir nicht begriffen, daß dort, wo sich zur Barbarei und zur Grausamkeit Zufall und Willkür gesellen, die Frage nach Sinn und Logik weltfremd und müßig ist.
Der Tote und seine Tochter
Es war am 21. Januar 1940, kurz nach dreizehn Uhr. Meine Mutter rief mich in die Küche. Sie blickte aus dem Fenster und war offensichtlich beunruhigt, doch, wie immer, ganz beherrscht. Auf dem Hof sah ich mehrere Nachbarn, etwa acht oder zehn an der Zahl. Sie gestikulierten lebhaft. Etwas mußte geschehen sein, etwas Aufregendes.
Noch standen wir erschrocken und unschlüssig am Fenster, da läutete schon jemand an unserer Wohnungstür: Der Doktor solle sofort kommen, denn der Herr Langnas habe sich aufgehängt; vielleicht könne man noch etwas machen. Aber mein Bruder war gar nicht zu Hause. Bevor ich auch nur einen Augenblick überlegen konnte, was ich tun sollte, sagte meine Mutter: »Geh sofort dahin, der Langnas hat doch eine Tochter, ihrer muß man sich jetzt annehmen.« Schon auf der Treppe, hörte ich die Stimme meiner Mutter: »Kümmere dich um das Mädchen!« Ich habe diesen Satz, diese Ermahnung – »Kümmere dich um das Mädchen!« – nie vergessen, ich höre sie immer noch.
Die Tür zur Wohnung, in der die aus Lodz nach Warschau geflüchtete Familie Langnas kürzlich Unterkunft gefunden hatte, war halb offen. In der Diele bemühten sich zwei oder drei Personen um die laut und, wie mir schien, feierlich, ja salbungsvoll klagende Frau Langnas. An der Wand lehnte, völlig aufgelöst, die Neunzehnjährige, um derentwillen ich gekommen war. Wir kannten uns schon, doch nur ganz flüchtig: Die Menschen, die zusammen in einem Haus wohnten, lernten sich damals rasch kennen. Um zwanzig Uhr war die von den deutschen Behörden verhängte Polizeistunde, danach durfte man das Haus nicht mehr verlassen.
Man wollte unbedingt wissen, was sich auf der Welt abspielte: Davon hing ja, das war schon bald allen klar, unser Leben ab. Nur konnte man der einzigen zugelassenen Tageszeitung in polnischer Sprache, einem erbärmlichen und allgemein verachteten Presseorgan, abgesehen von den Meldungen des Oberkommandos der Wehrmacht so gut wie nichts entnehmen – und der in deutscher Sprache erscheinenden »Warschauer Zeitung« kaum mehr. Alle Rundfunkapparate hatten wir schon im Oktober 1939 abliefern müssen. Also war man auf die von Mund zu Mund gehenden Nachrichten angewiesen, die nicht immer zutrafen, und auf die sich unentwegt verbreitenden Gerüchte, die nicht immer falsch waren.
Das ständige Bedürfnis nach Neuigkeiten, wenn schon nicht erfreulichen, so doch wenigstens beruhigenden, ähnelte bald einer Sucht. Eben damit hatten die gegenseitigen abendlichen Besuche innerhalb eines Hauses zu tun: Man traf sich bei einem der Nachbarn, um das Allerneueste zu erfahren. »Was gibt es Neues?« – lautete die stereotype Frage. Ich habe sie
Weitere Kostenlose Bücher