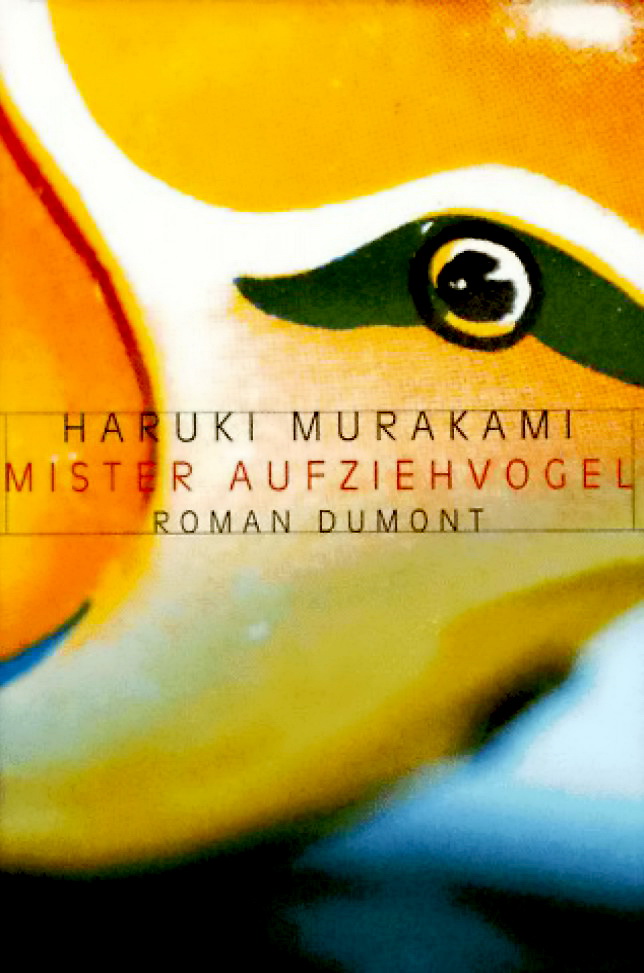![Mister Aufziehvogel]()
Mister Aufziehvogel
vermitteln. Wenn ich dagegen nicht aufhörte, wahllos Männer anzusprechen, würde man mich, früher oder später, in irgendeinem Hotelzimmer erdrosselt auffinden. Von da an brauchte ich nicht mehr an Straßenecken zu stehen. Ich brauchte nur abends in ihre Zentrale zu kommen, und sie sagten mir, in welches Hotel ich gehen sollte. Sie vermittelten mir gute Freier, genau wie sie es versprochen hatten. Ich weiß nicht warum, aber ich wurde wie etwas Besonderes behandelt. Vielleicht lag es daran, daß ich so unschuldig aussah. Ich hatte ein kultiviertes Auftreten, das den anderen Mädchen fehlte. Wahrscheinlich gab es eine Menge Freier, die diesen nicht so professionellen Typ bevorzugten. Die anderen Mädchen hatten drei und mehr Freier am Tag, aber ich konnte mein Soll schon mit einem einzigen oder, wenn’s hoch kam, mit zwei erfüllen. Die anderen Mädchen trugen Beeper bei sich und wurden von der Zentrale ganz kurzfristig in irgendwelche Absteigen geschickt, wo sie mit zwielichtigen Männern schlafen mußten. Ich dagegen hatte immer richtige Verabredungen in richtigen, erstklassigen Hotels - manchmal sogar in Privatwohnungen. Meine Freier waren in der Regel ältere Männer, selten jüngere.
Die Zentrale bezahlte mich einmal die Woche. Es war nicht so viel, wie ich als Selbständige verdient hatte, aber einschließlich der Trinkgelder, die ich von den Freiern erhielt, kam immer eine recht ordentliche Summe zusammen. Manche Freier verlangten natürlich ziemlich abwegige Sachen von mir, aber mich störte das nicht. Je abwegiger der Wunsch, desto höher das Trinkgeld. Ein paar Männer fingen an, regelmäßig nach mir zu verlangen. Solche Stammkunden waren meist recht großzügig. Ich legte mein Geld auf verschiedenen Konten an. Aber Geld bedeutete mir mittlerweile nichts mehr. Eine Zahl auf einem Stück Papier, weiter nichts. Jetzt lebte ich nur noch für eines: mir selbst zu beweisen, daß ich nichts empfand. Ich wachte morgens auf und vergewisserte mich, daß mein Körper nichts signalisierte, was die Bezeichnung Schmerz verdient hätte. Ich öffnete die Augen, sammelte langsam meine Gedanken und überprüfte dann systematisch, von Kopf bis Fuß, jede Empfindung, die ich in meinem Körper vorfand. Ich spürte nicht den geringsten Schmerz. Bedeutete dies, daß ich keine Schmerzen hatte oder aber daß ich zwar welche hatte, sie aber nicht spürte? Ich konnte dazwischen nicht unterscheiden. Jedenfalls tat es nicht weh. Ja, genaugenommen hatte ich überhaupt keine Empfindungen. Nach dieser Prozedur stand ich auf, ging ins Badezimmer und putzte mir die Zähne. Dann zog ich den Pyjama aus und nahm eine heiße Dusche. Mein Körper war von einer erschreckenden Leichtigkeit, so leicht und luftig, daß er sich gar nicht wie mein Körper anfühlte. Ich fühlte mich so, als habe sich mein Geist in einem fremden Körper niedergelassen. Ich betrachtete ihn im Spiegel, aber zwischen mir und dem Körper, den ich da sah, spürte ich eine entsetzlich weite Distanz.
Ein Leben ohne Schmerzen: Genau davon hatte ich jahrelang geträumt, aber jetzt, wo ich ein solches Leben hatte, gelang es mir nicht, einen Platz für mich darin zu finden. Eine Kluft trennte mich von ihm, und das verwirrte mich zutiefst. Ich hatte das Gefühl, nicht in der Welt verankert zu sein - in dieser Welt, die ich bis dahin so inbrünstig gehaßt hatte, die ich nicht müde geworden war, der Grausamkeit und Ungerechtigkeit zu zeihen; dieser Welt, in der ich jedoch wenigstens gewußt hatte, wer ich war. Nun hatte die Welt aufgehört, die Welt zu sein, und ich hatte aufgehört, ich zu sein.
Ich weinte viel. Jeden Nachmittag ging ich in einen Park - in den Kaiserlichen Garten von Shinjuku oder den Yoyogi-Park -, setzte mich ins Gras und weinte. Manchmal weinte ich, laut schluchzend, ein, zwei Stunden lang. Die Passanten starrten mich an, aber das kümmerte mich nicht. Ich wünschte mir, ich wäre in jener Nacht des neunundzwanzigsten Mai wirklich gestorben, hätte meinem Leben ein Ende gemacht. Wieviel besser wäre ich dann drangewesen! Nun konnte ich nicht einmal mehr sterben. In meiner Betäubung fand ich einfach nicht die Kraft, mich umzubringen. Ich spürte nichts: keinen Schmerz, keine Freude. Jede Empfindung war aus mir verschwunden. Und ich war nicht einmal mehr ich.« Kreta Kano atmete tief ein und hielt die Luft an. Dann hob sie ihre Kaffeetasse, starrte eine Weile hinein, schüttelte leicht den Kopf und stellte die Tasse auf ihre Untertasse zurück.
»Etwa
Weitere Kostenlose Bücher