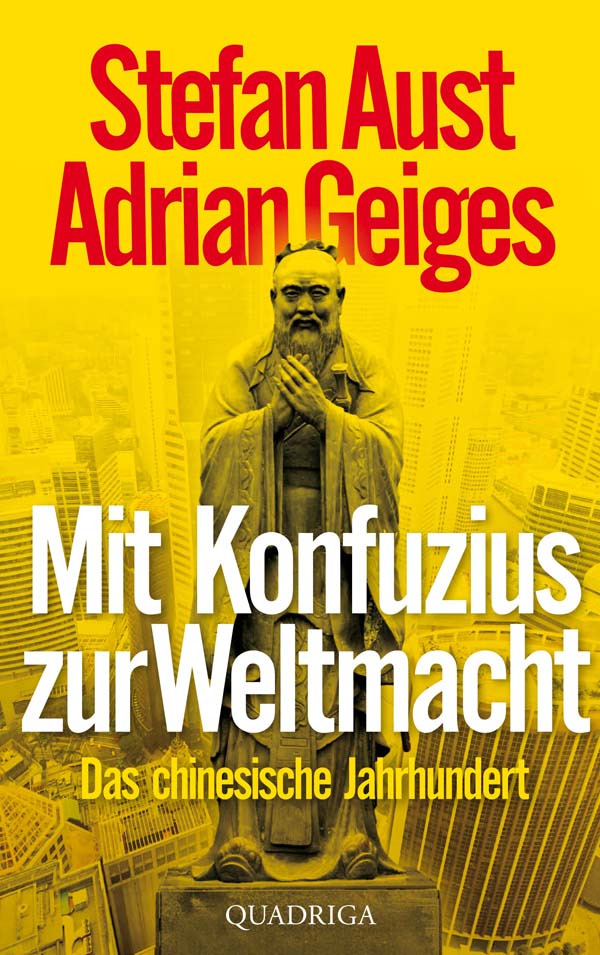![Mit Konfuzius zur Weltmacht]()
Mit Konfuzius zur Weltmacht
würden. Zu einem umfassenden Bild gehören die Erfolge beim Bau von Schulen und Krankenhäusern – aber auch die Tatsache, dass Tibeter in Gefängnissen und Straflagern verschwinden, nur weil in ihrem Haus ein Bild des Dalai Lama hängt.
Ein Drache schlingt sich um eine Säule. Teenager in Trainingsanzügen tragen Federn, die fast so groß sind wie sie selbst, andere Jugendliche trommeln. Eine Zeremonie im Konfuzius-Tempel von Taipeh, der Hauptstadt von Taiwan, Chinas abtrünniger Provinz. Am Eingang des Tempels zünden Dutzende Bürger Räucherkerzen an. Ihre Mienen sind ernst, es fehlt das touristische Tohuwabohu, das an solchen Orten in der Volksrepublik China herrscht. Anders als dort wurde die konfuzianische Tradition in Taiwan nie unterbrochen. Und es ist eine neue Tradition hinzugekommen: die demokratische. Zwar herrschte auch Chiang Kai-shek, Maos Gegenspieler im Bürgerkrieg, wie ein Diktator, nachdem er 1949 mit seinen Anhängern auf die Insel geflohen war. Doch nach seinem Tod wurde Taiwan Schritt für Schritt liberalisiert und ist heute eine Demokratie – somit auch ein Beispiel dafür, dass sich Konfuzianismus, chinesische Besonderheiten und demokratischer Rechtsstaat nicht ausschließen.
Wahlkampf 2008: »Ihr seid Betrüger!«, schrie Bankdirektor Huang Jinchang die Rentnerin Chen Xiangmei, auf einem Gehweg unweit vom Präsidentenpalast, an. »Euer Präsident Chen Shui-bian ist schamlos!«, geiferte sie zurück. Immer mehr Menschen strömten zusammen, schlugen sich in dem Streit auf die eine oder andere Seite. Der Bankdirektor und seine Freunde trugen weiße T-Shirts mit der Aufschrift »Taiwan – mein Land« und unterstützten damit die Aktion ihres damals amtierenden Präsidenten Chen Shui-bian für einen Beitritt der Insel zur UNO unter dem Namen Taiwan. »Unser Land hat eine eigene Regierung, eine Armee und eigenes Geld, wir sind ein souveränes Land und eine Demokratie, wir wollen unsere Würde!«, rief eine Unabhängigkeitsverfechterin. Ein Gegner erwiderte: »Eure Unabhängigkeit wird von fast niemandem auf der Welt anerkannt, und die UNO wird uns nicht aufnehmen.« Aus Peking kommend, überraschte einen an dem Streit vor allem, dass er überhaupt stattfand. In der Volksrepublik China hätte die Polizei die Teilnehmer einer der beiden Gruppen festgenommen, wahrscheinlich beide.
Die Rentnerin und ihre Gesinnungsgenossen trugen rote Fahnen mit einer weißen Sonne auf blauem Grund im linken oberen Eck. Dies war die Flagge Chinas vor der kommunistischen Revolution 1949 – und ist bis heute die Flagge der Republik China, eines Landes, das kaum noch jemand unter diesem Namen kennt. Die meisten Menschen nennen die Insel mit 23 Millionen Einwohnern Taiwan. Das wollte der damalige Präsident Chen Shui-bian zum Staatsnamen machen.
Und da kam er auch schon angerannt, ebenfalls in weißem T-Shirt und Turnhose, mit dem Dauerlächeln, das zu seinem Markenzeichen geworden war, und mit einer Fackel in der Hand. Nein, kein Doppelgänger oder Maskenträger, sondern der Präsident persönlich. Mit Fackel für den UNO-Beitritt zu demonstrieren war eine Provokation gegen die Pekinger Führung. Diese wollte das olympische Feuer durch Taiwan tragen lassen, allerdings unter der Bedingung, dass auf dem Weg weder taiwanesische Fahnen zu sehen sein sollten noch die taiwanesische Hymne gespielt würde. Taiwans damalige Regierung gab Peking einen Korb.
Auch die Gegenpartei demonstrierte an diesem Tag sportlich: Ma Ying-jeou, Spitzenkandidat der Nationalpartei Guomindang, radelte mit seinen Anhängern. Er ist für die Einheit Chinas, weshalb Pekings Führung ihn vorzieht. Unter kommunistischem Vorzeichen möchte aber auch er nicht vereinigt werden − aus gutem Grund: Im Bürgerkrieg metzelten Kommunisten die Guomindang nieder, weshalb ihre Aktivisten nach Taiwan flohen und so eines der heutigen Dilemmas der Insel schufen – den Widerspruch zwischen den ursprünglichen Einwohnern mit einer eigenen Identität, zu denen der ehemalige Präsident Chen Shui-bian gehört, und den Einwanderern, die sich als Chinesen verstehen.
»Chen Shui-bian hat uns Einwanderer Schweine genannt«, behauptete die Rentnerin Chen Xiangmei, klammerte sich an ihre Fahne und begann zu weinen. Der 85-jährige Liu Shanbin krempelte seinen Ärmel hoch und zeigte Wunden, die ihm die Japaner im Krieg gegen China zugefügt hatten. Jetzt lebte er von der Sozialhilfe und schlief auf einer Strohmatte im Bahnhof, da er keine Wohnung mehr bezahlen
Weitere Kostenlose Bücher