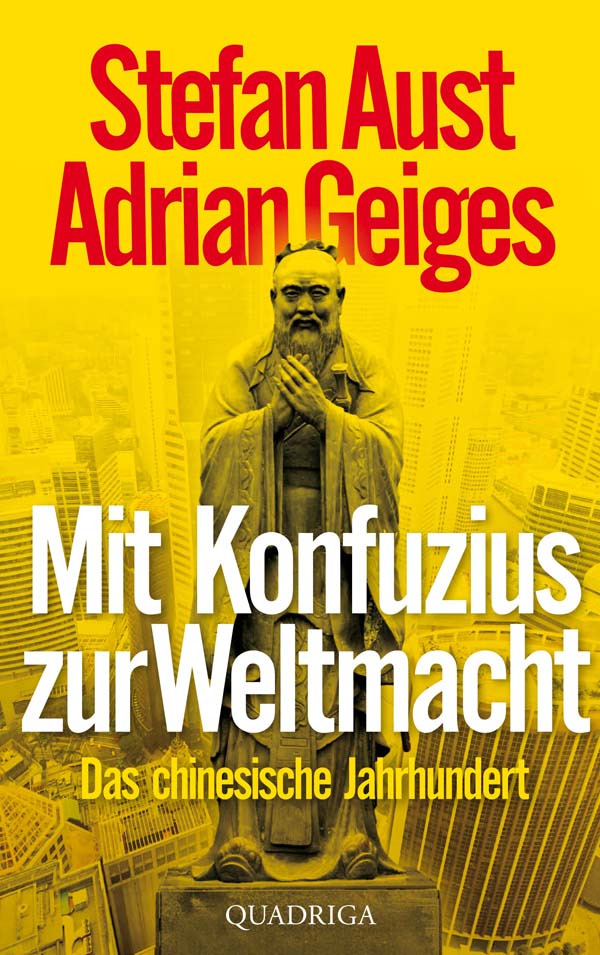![Mit Konfuzius zur Weltmacht]()
Mit Konfuzius zur Weltmacht
Die Gebäude liegen nahe dem Fußballstadion des 11. November, das nach dem Tag der Unabhängigkeit von Portugal 1975 benannt ist. Es ist ebenfalls made by China, wurde von der Shanghai Urban Construction Group erbaut.
Alles beruht auf dem gleichen Deal: China hat Angola zinsgünstige Kredite in Höhe von 15 Milliarden Dollar gegeben, die Angola mit Öl abbezahlt. Der Kampf ums Öl wird mit Bagger und Schaufel geführt – statt Geld bekommen die Afrikaner Gebäude, gebaut von Chinesen. Die wissen schließlich, wie das geht, haben sie in ihrem eigenen Wirtschaftsaufschwung doch reichlich Erfahrung gesammelt. Vor den neuen Hochhäusern beim Stadion planieren die Chinesen noch Wege und legen Gärten an. Angolaner arbeiten auch mit, wenngleich sie in der Minderzahl sind. Man kann beobachten, wie sie von Chinesen herumkommandiert werden – hier hat die neue Weltmacht das Sagen. »Sehr viele von uns Chinesen arbeiten jetzt hier«, sagt einer der Arbeiter, der sich als Li vorstellt. Er kommt aus einem Dorf nahe der ehemaligen deutschen Kolonie Qingdao und hat einen Vertrag für anderthalb Jahre Angola unterschrieben. »China und Angola sind Geschäftspartner. Die Regierung hat uns entsandt, wir haben ein großes Kooperationsprogramm.«
Auf dem schwarzen Kontinent gründen die Chinesen provisorische Siedlungen, so auch neben den neuen Apartmentgebäuden. Die rote chinesische Fahne weht neben derjenigen von Angola. Gleich ist beiden Flaggen der fünfzackige gelbe Stern, auf der angolanischen kreuzt eine Machete ein Zahnrad, was nicht zufällig an Hammer und Sichel erinnert.
An Wäscheleinen auf den Balkonen des Arbeiterwohnheims hängen Kopien von Calvin-Klein-Unterhosen, davor kauern Chinesen mit nackten Oberkörpern. Die Lebensbedingungen sind karg. Auf der anderen Hälfte des Erdballs warten Ehefrauen und Kinder, doch verdienen die Arbeiter hier doppelt so viel wie zu Hause und sparen so für die Zukunft ihrer Familien. Und sie wissen, dass sie einer großen Sache dienen. »Für China ist das gut«, meint einer, der Xue heißt. Ihm fällt ein anderer ins Wort, der ebenfalls den Familiennamen Xue trägt, verwandt sind sie aber nicht: »China entwickelt sich so schnell. Wir brauchen Rohstoffe, denn unsere Bevölkerung ist sehr groß.« Der erste Xue ergänzt: »China benötigt Öl, und dies ist ein großes Ölland. Wir schuften hier, und das Öl kommt zu uns.«
Die angolanischen Jungs, die vor dem chinesischen Essensstand herumhampeln, sagen, in ihrer Muttersprache Kimbundu befragt: »Die Chinesen sind arrogant, sie schauen auf uns herab.« Bei den Gastarbeitern aus Fernost hört sich das so an: »Hier herrscht Chaos, wir gehen kaum noch aus unserer Siedlung heraus. In Angola fürchten wir um unser Leben.« Der Chinesische Wirtschaftsrat CBC, der 40 Firmen in Angola vertritt, spricht von zwei bis drei Überfällen pro Tag. So wurden in Luanda chinesische Arbeiter mit kochendem Wasser übergossen, von mehreren Morden ist die Rede. Tobt ein neuer Rassenkrieg?
Politologe Orlando Ferraz sieht die Gewaltbereitschaft als Folge des beinahe 30-jährigen Bürgerkriegs von 1975 bis 2002 mit einer halben Million Toten, der sich fast nahtlos anschloss an den Unabhängigkeitskrieg gegen die portugiesischen Kolonialherren 1961 bis 1974. Das Engagement der Chinesen bewertet er positiv: »Nach dem Bürgerkrieg, als niemand mit uns zu tun haben wollte, hat China schnell und unkompliziert mit Krediten geholfen.« Aber auch Ferraz bemängelt: Bei den Bauprojekten würden zu wenig Angolaner beschäftigt, zudem sollten die Chinesen mehr für die Ausbildung der Einheimischen tun. Von einem »neuen Kolonialismus« zu sprechen, sei aber absurd. Der Politologe hat kein Problem damit, dass das Geld aus den Krediten überwiegend wieder an chinesische Firmen fließt. »Sie verbessern unsere Infrastruktur, bauen etwa Straßen. Ich schaffe es jetzt viel schneller ins Büro. Bananen und andere Lebensmittel erreichen die Kunden, bevor sie verfaulen.«
Wer sich durch den Moloch Luanda bewegt, spürt sofort, wie drängend das Problem ist: Werktags bricht der Verkehr ab sechs Uhr morgens in weiten Teilen der Metropole zusammen, auf den zerklüfteten oder einspurigen Straßen geht gar nichts mehr. »Die Chinesen sind selbst dabei, sich zu entwickeln«, sagt Orlando Ferraz. »Deshalb können sie uns besser verstehen, sich besser in uns hineinversetzen als die Europäer.«
Auch Europäer selbst geben das zu. Bauingenieur Bernhard Streit ist seit 1972 in
Weitere Kostenlose Bücher