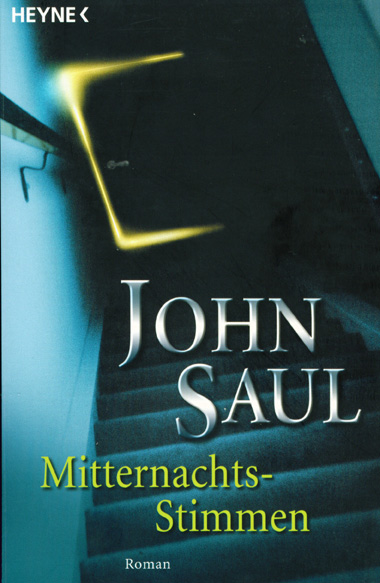![Mitternachtsstimmen]()
Mitternachtsstimmen
Tür auf, und sie stand dem Mann gegenüber,
den sie schon einmal gesehen hatte, als er in die Wohnung der
Albions ging.
Und er erkannte sie offenbar auch wieder, denn er zog die
Tür weit auf, trat einen Schritt zurück und winkte sie mit einem
Lächeln herein. »Jetzt fällt es mir wieder ein«, sagte er, und
seine tiefe Stimme füllte mühelos die geräumige Diele seiner
Wohnung. »Sie sind die Frau von der Stadt, die immer mal
wieder nach Rebecca sieht! Ich wusste doch, dass mir Ihr
Name bekannt vorkam.« Auf einmal verschwand sein Lächeln,
und seine Stirn umwölkte sich. »Sie kommen doch hoffentlich
nicht wegen der Kleinen?«
Andrea sah sich rasch um, ehe sie antwortete. Die Wohnung
glich der der Albions: von der großzügigen Diele gingen
etliche Räume ab; die meisten der Türen waren jedoch geschlossen. Dr. Humphries, der ihren musternden Blick bemerkt
hatte, ging zur nächst gelegenen Tür und zog sie auf. »Praxis
und Behandlungszimmer«, erklärte er und komplimentierte sie
in den Raum, der eher einem eleganten Arbeitszimmer denn
einer Arztpraxis glich. Die Wände verschwanden hinter
riesigen Bücherregalen, gegenüber dem Kamin stand ein
großes Chesterfield-Sofa, flankiert von zwei Tischchen mit
jeweils einer Tiffany-Lampe darauf und zwei Ohrensesseln mit
dem gleichen dunkelroten Lederbezug wie das Sofa. Auf der
anderen Seite stand ein großer Schreibtisch mit komfortabel
aussehenden Stühlen auf beiden Seiten. »So, suchen Sie mich
als Patientin auf, oder geht es um Rebecca?«
»Um Rebecca«, erwiderte Andrea. »Ich sah sie gestern und
bin sehr besorgt,«
»Aber es geht ihr schon viel besser«, sagte Humphries und
bedeutete ihr mit einer Handbewegung, vor dem Schreibtisch
Platz zu nehmen, während er sich auf den Stuhl dahinter setzte.
»Außer es ist seit meinem Besuch letzte Woche etwas
passiert.«
»Sie scheint mir so …« Andreas Stimme brach ab, während
sie nach dem richtigen Wort suchte. »Ich weiß nicht – sie wirkt
irgendwie kränklich.«
Humphries’ Lippen arrangierten sich zu einem Lächeln.
»Freut mich, dass Sie das bemerkt haben.«
»Können Sie mir sagen, was ihr fehlt?«
»Selbstverständlich kann ich das«, gab Humphries zurück.
»Aber ich weiß nicht, ob ich das sollte. Die Krankengeschichten meiner Patienten sind vertraulich.«
»Aber Sie sind kein M.D.«
Humphries’ Lächeln verschwand, und seine Stimme wurde
hart. »Geht es Ihnen darum? Um meine Referenzen?«
»Rebecca Mayhew untersteht meiner Verantwortung«,
entgegnete Andrea, seiner Frage ausweichend.
»Und meiner ebenso.« Humphries erhob sich. »Kann ich
sonst noch etwas für Sie tun?«
Plötzlich wurde Andrea wütend. Was glaubte dieser
Humphries eigentlich, wer er war? Dass er offensichtlich nicht
am Hungertuch nagte, gab ihm noch lange nicht das Recht, sie
daran zu hindern, ihre Arbeit zu tun. »Wenn ich es für nötig
erachte, kann ich Rebeccas Krankengeschichte gerichtlich
einfordern«, beschied sie ihm und blieb sitzen. »Halten Sie es
nicht für einfacher, wenn Sie mir hier und jetzt erzählen, was
ihr fehlt?«
Humphries stand nun neben ihr, und seine Augen glitzerten
dunkel, als er auf sie herabblickte. »Gewiss wäre das
›einfacher‹. Aber nur weil es einfacher wäre, muss ich es noch
lange nicht tun, Miss Costanza. Und ich hege auch ernsthafte
Zweifel, dass Sie aufgrund Ihrer Beobachtung, dass Rebecca
›kränklich‹ wirkt, irgendeine gerichtliche Verfügung erwirken
können. Wenn Sie mich jetzt also entschuldigen würden, ich
muss mich um meine Patienten kümmern.«
»Tatsächlich?«, meinte Andrea spitz und stand nun auf. »Um
wen denn? Wer kommt denn jemals zu ihnen?« Sie sah sich in
dieser merkwürdig eleganten Praxis um. »Woher weiß ich, dass
das hier wirklich eine Arztpraxis ist? Und Sie überhaupt ein
Arzt sind?«
»Gar nicht«, gab Humphries zurück, ganz die Ruhe selbst. Er
ging zur Tür und hielt sie für sie auf. »Obgleich ich davon
überzeugt bin, dass Sie alles daransetzen werden, es herauszufinden. Ich an Ihrer Stelle würde es jedoch bleiben lassen.
Rebecca wird es gut gehen.«
Andrea kniff die Augen zusammen. »Drohen Sie mir?«
Humphries durchbohrte sie mit seinem Blick. »Machen Sie
sich nicht lächerlich. Ich habe es nicht nötig, Ihnen oder
irgendjemandem zu drohen. Ich habe Ihnen nur gesagt, was ich
an Ihrer Stelle tun würde.« Plötzlich waren sie an der Tür, die
offen war, und Andrea stand draußen im Flur. »Guten Tag,
Weitere Kostenlose Bücher