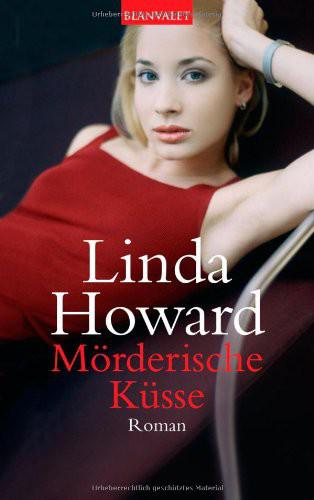![Moerderische Kuesse]()
Moerderische Kuesse
Chef oder gemeinen Nachbarn anlegen musste? Oder wenn sie auf offener Straße überfallen würde? Würde sie dann ihre Instinkte beherrschen können, oder würde jemand sterben müssen?
Und wenn sie, was noch schlimmer wäre, unabsichtlich einen geliebten Menschen in Gefahr brächte? Sie wusste, dass sie es nicht ertragen würde, wenn jemand in ihrer Familie ihretwegen oder wegen ihrer Vergangenheit zu Schaden kam.
Ein Auto hupte, und Lily zuckte zusammen, augenblicklich wieder hellwach und konzentriert. Sie war entsetzt, dass sie derart in Gedanken versunken war, statt aufmerksam und konzentriert zu bleiben. Wenn sie ihre Konzentration nicht halten konnte, würde sie das hier unmöglich durchziehen können.
Vielleicht war sie bis jetzt unter dem Radar der CIA durchgetaucht – so hoffte sie wenigstens –, aber das würde nicht ewig so bleiben. Irgendwann würde sich jemand an ihre Fersen heften, und das wahrscheinlich schon ziemlich bald.
Bei realistischer Betrachtung gab es vier mögliche Schlussszenen für diese Situation. Im besten Fall würde sie herausfinden, weshalb Averill und Tina wieder in den Job eingestiegen waren, und diese Sache wäre so schrecklich, dass sich die gesamte Welt von den Nervis distanzieren würde, bis sie ihr Geschäft aufgeben mussten. Die CIA würde Lily natürlich nie wieder einsetzen; so berechtigt ihre Beweggründe auch sein mochten, ein Agent, der auf eigene Faust einen wichtigen Partner tötete, war viel zu instabil für diesen Job. Sie würde ihr Ziel also erreichen, wäre allerdings arbeitslos, was sie wieder zurück zu ihrer ursprünglichen Sorge brachte, ob sie tatsächlich ein ganz normales Leben führen konnte.
Im zweitbesten Fall würde sie auf nichts wirklich Belastendes stoßen – dass die Nervis Waffen an Terroristen verkauften, würde nicht reichen, denn das war sowieso bekannt – und wäre fortan gezwungen, unter falschem Namen zu leben. In diesem Fall wäre sie ebenfalls arbeitslos und stünde vor der Frage, ob sie sich in einem ganz normalen Job halten könnte und ein Leben als Namenlose ertragen würde.
Die beiden anderen Szenarien waren ausgesprochen freudlos. Entweder sie kam zum Ziel, wurde aber dabei getötet.
Oder aber, schlimmstenfalls, würde sie getötet, bevor sie irgendwas erreicht hatte.
Sie hätte sich gern mit dem Gedanken getröstet, dass die Chancen für einen positiven Ausgang bei fünfzig Prozent lägen, aber die vier Möglichkeiten waren, was ihre Wahrscheinlichkeit anging, höchst ungleich verteilt. Ihrer Einschätzung nach lag die Wahrscheinlichkeit, dass sie diesen Einsatz nicht überlebte, bei etwa achtzig Prozent, was möglicherweise noch optimistisch gerechnet war. Trotzdem würde sie alles versuchen, um ihre zwanzig Prozent zu nutzen. Sie durfte Zia nicht enttäuschen, indem sie einfach aufgab.
Das Quartier Latin war ein Labyrinth kleiner gepflasterter Gassen, durch das sich normalerweise die Studenten der nahen Sorbonne und Massen von Kauflustigen schoben, die sich für die skurrilen Läden und Ethno‐Boutiquen interessierten, aber heute hatte der kalte Regen die Menschen vertrieben. Im Internetcafe herrschte trotzdem Betrieb. Während Lily ihren Schirm zusammenklappte und Regenmantel, Halstuch und Handschuhe auszog, ließ sie den Blick durch das Cafe schweifen, um zu entscheiden, an welchem Computer sie am wenigsten auffiel. Unter ihrem gefütterten Regenmantel trug sie einen dicken Rollkragenpullover in einem kräftigen Blau, das ihre Augen dunkler wirken ließ, und eine weite Wollhose über niedrigen Stiefeletten. Um ihr rechtes Fußgelenk hatte sie ein Fußholster mit einem .22er‐Revolver geschnallt, der dank der Stiefeletten leicht zugänglich war, ohne dass er sich unter der weiten Hose abgezeichnet hätte. Wochenlang hatte sie keine Waffe tragen können, weil sie jedes Mal abgetastet worden war, wenn sie in Salvatores Nähe kam, und sie hatte sich dabei schrecklich schutzlos gefühlt; so war es schon besser.
Sie entdeckte einen freien Computer in einer Ecke, von wo aus sie die Tür im Auge behalten konnte und wo sie zugleich so abgeschieden saß, wie es in diesem Cafe überhaupt möglich war. Allerdings saß im Moment eine junge Amerikanerin davor, die offenbar ihre E‐Mails las. Amerikaner waren unschwer zu erkennen, wie Lily festgestellt hatte; nicht nur an ihrer Kleidung oder ihrem Stil, sie hatten auch etwas an sich, ein natürliches Selbstbewusstsein, das ab und zu an Arroganz grenzte und auf einen Europäer
Weitere Kostenlose Bücher