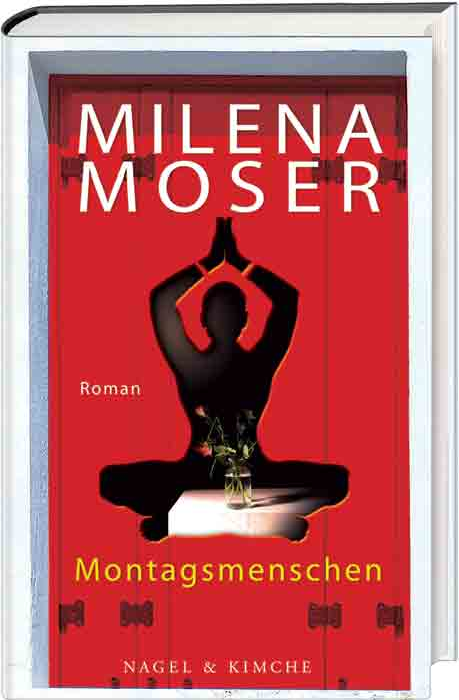![Montagsmenschen - Moser, M: Montagsmenschen]()
Montagsmenschen - Moser, M: Montagsmenschen
darauf. ‹Ou, das haben wir aber noch nie so gemacht!› Oder: ‹Ja, aber das haben wir schon immer so gemacht!› Anders kann die Schweiz mit Neuem nicht umgehen!»
Auf Maries Mutter traf das jedenfalls zu. Und Marie fragte sich manchmal, wie sehr sie diese Einstellung geprägt hatte. Wie wenig sie sich bisher getraut hatte. Bisher, dachte sie. Bisher.
Marie trat an das Geländer und schaute über die rostfarben gestrichenen Häuserblöcke, die exakt abgemessenen grünen Rasenquadrate, unterbrochen von grauen Sandkästen, verbunden mit rechtwinkligen Wegen. Da unten lag es. Ihr Dorf.
Ihr Vater stellte sich neben sie.
«Also, ich könnte hier nicht leben», sagte er.
«Musst du ja auch nicht.» Marie schob ihre Hand unter seinen Arm. Automatisch nahm er ihre Hand, wie er es immer tat, und tätschelte sie abwesend. Unten auf den Wegen bewegten sich kleine Menschen, eine in Schwarz gehüllte Frau schob einen Kinderwagen, ein junger Mann zog eine weiße Kapuze über seinen Kopf.
«Was sind das wohl für Menschen?»
Meine Patienten, dachte Marie. «Ich habe keine Ahnung», sagte sie. «Aber ich werde sie kennenlernen.»
Die Siedlung war neu. Neunhundert Wohnungen, dreitausend Bewohner, zweitausend von ihnen unter achtzehn. Der Ausländeranteil betrug beinahe achtzig Prozent. Diese Siedlung war ein Dorf. Diese Siedlung brauchte medizinische Versorgung. Marie hatte die Stellenausschreibung erst überlesen. Sie bot keine klassische Hausarztposition an, sondern eine Stelle in einer Gemeinschaftspraxis, die Teilnahme an einem Versuchsmodell, einem neuartigen Konzept der Gesundheitsversorgung.
Doch dann zog Mira Mehmeti mit ihren Kindern in diese Siedlung. Assistenzarzt Maurer erzählte Marie davon, und auch von der Gemeinschaftspraxis und der Arbeitsstelle. Am liebsten würde er sich selber bewerben, sagte er, wenn er nur seine Assistenzzeit schon abgeleistet hätte. Marie kaufte Brot und Salz als Einstandsgeschenk und besuchte Mira in ihrer neuen Wohnung. Sie tat so, als sähe sie den Schnappschuss am Kühlschrank nicht, der einen lachenden Dr. Maurer vor einem Giraffengehege zeigte, den kleinen Joshua auf den Schultern tragend. Sie schaute sich die Siedlung an. Sie sprach mit der Frauenärztin, die bereits in der Gemeinschaftspraxis arbeitete. Und sie dachte: Was hier gesucht wird, ist eine Hausärztin. Wer hier gesucht wird, bin ich.
«Bei uns im Dorf werden jetzt auch Wohnungen gebaut», sagte Martin Leibundgut, dann brach er ab. «Aber das ist wohl nichts für dich.»
«Nein, Papa.»
«Ja nun, du musst es wissen.»
«Ich weiß es.»
Marie lehnte sich an ihren Vater. Seine Hand drückte ihre und ließ sie wieder los, drückte und ließ los. Ihr Vater hatte immer warme Hände. Weiche Hände. Bürolistenhände, nannte sie ihre Mutter, spöttisch und gleichzeitig stolz. Marie erinnerte sich, wie ihr Vater mit diesen Händen einen Jungen gepackt hatte, der sie auf dem Schulweg verfolgt und ihr die Schultasche entrissen hatte. Er hatte den Jungen an den Schultern seiner Windjacke hochgehoben und geschüttelt, der Junge hatte geweint. Nie wieder war Marie auf dem Schulweg belästigt worden: Ihr Vater war stark. Das wussten alle.
«Aber nicht, dass du mir einen -itsch nach Hause bringst», sagte Martin jetzt, und Marie nahm ihren Kopf von seiner Schulter.
«Papa, also wirklich!»
«Ich meine ja nur.»
Marie schüttelte den Kopf. Sie ging in die Wohnung zurück. Sie dachte an Ted, der ihre Anrufe nicht beantwortete. Es machte ihr nichts aus. Er würde schon zu ihr kommen. Früher oder später. Das wusste sie. Sie konnte es nicht erklären. Sie wusste es einfach. Und es machte sie glücklich.
Sie hatte ihn da stehen sehen, auf der anderen Straßenseite, in der Nähe des Kantonsspitals, als sie gerade ihre Stelle gekündigt hatte. Sie war nach draußen gegangen, um eine Zigarette zu rauchen, war ein paar Schritte gegangen, und noch ein paar, bis ans Ende der Straße. Sie hatte sich frei gefühlt. Alles war möglich. Und da stand er. Er hatte den Kopf in den Nacken gelegt und sein Gesicht dem Sommerregen entgegengehalten, er hatte genau so ausgesehen, wie sie sich in diesem Moment fühlte. Etwas war geplatzt in ihr. Etwas Großes quoll aus dem Nichts hervor und machte sich breit, etwas Helles, Leichtes, ein Blubbern, ein Kichern. Sie warf die halbgerauchte, regenfeuchte Zigarette in eine Pfütze und hielt die Hände wie einen Trichter vor den Mund.
«Du und ich, wir gehören zusammen!», schrie sie über die
Weitere Kostenlose Bücher