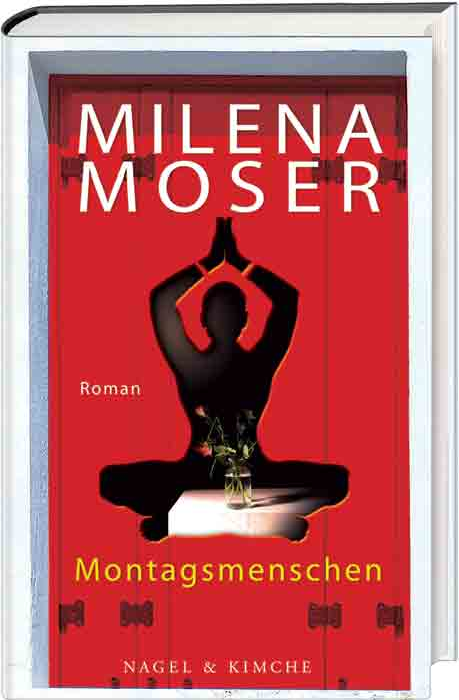![Montagsmenschen - Moser, M: Montagsmenschen]()
Montagsmenschen - Moser, M: Montagsmenschen
Gäste bezahlten und verließen das Lokal. Hier aßen noch alle zur selben Zeit. Nevada und Martha standen eine Weile im Eingang herum, ließen die Gäste an sich vorbei, bis eine Kellnerin sie entdeckte.
«Essen?», fragte sie knapp.
Martha und Nevada schauten einander an. Haben Sie auch vegetarische Gerichte?, wollte Nevada fragen, aber es kam ihr nicht über die Lippen. Martha nickte. «Essen.»
«Das Tagesmenü hab ich nicht mehr. Und wenn ihr von der Karte bestellen wollt, müsst ihr euch beeilen. Die Küche schließt in einer Viertelstunde!»
«Ist gut.» Sie setzten sich und studierten die Karte.
«Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so etwas gegessen habe», sagte Martha.
«Ich auch nicht.»
«Sollen wir den Salatteller nehmen?» Martha schaute die Karte unsicher an. Als könnte sie ihr ins Gesicht springen. «Oder vielleicht die Tagessuppe? Man kann schon etwas Warmes vertragen, bei der Kälte heute. Soll ich fragen, was drin ist?»
«Nein», sagte Nevada. «Heute nicht.» Sie spürte immer noch die große Hand eines überdimensionierten Kinoaffen, der sie hielt. Vielleicht war es auch die Hand Gottes. Wer Gott auch sein mochte. Isvarah pranidhana, dachte sie. Die Hingabe an Gott ist auch eine Möglichkeit, den Zustand Yoga zu erreichen. Patanjali Yoga Sutra 1.23. Dieses Sutra und die drei darauffolgenden hatte sie beim Studium geflissentlich übersprungen. Obwohl das Lehrbuch, das sie dazu benutzte, deutlich erklärte, dass kein spezifischer Gott gemeint sei, keine bestimmte Religion, einfach eine grundsätzlich übergeordnete Macht.
«Sie können statt an Gott auch an Ihre Eltern denken», hatte der indische Lehrer damals gesagt, und Nevada hatte gelacht. Absolute Hingabe an ihre Eltern. Absolutes Vertrauen. Vermutlich wäre sie längst tot. Im Alkohol ertrunken wie ihr Vater, verhungert wie ihre Mutter.
Hör auf, deine Mutter lebt noch.
Gott war das größte Problem im Yogaunterricht, in den Schriften, in den Sutras. «Verschon mich mit dem esoterischen Zeug», sagten ihre Schüler, vor allem in der ersten Stunde. «Ich bin hier, um mich zu bewegen, um meinen Körper zu spüren, ich will meine Rückenschmerzen loswerden und meinen Po straffen, keinesfalls will ich irgendwelche obskuren indischen Götter anbeten oder stundenlange Gebete runterleiern, vielen Dank!» In New York war es einfacher gewesen, die Amerikaner sprachen über Gott, als sei er ein alter Bekannter, eine konstante Präsenz, jemand, dessen Namen sie mit einer gewissen Vertrautheit aussprechen konnten. Doch Nevada war das immer fremd gewesen, und sie hatte sich schon damals geweigert, die Sutras, die sich auf Gott bezogen, vorzusingen. «Das Universum», sagte sie stattdessen, «das Absolute, der Geist.»
Heimlich glaubte sie immer noch an den Gott ihrer Kindheit. Einen strengen Vater, dem man nicht gerecht werden konnte, so sehr man sich auch bemühte. Doch das Versprechen, die Hoffnung auf Erlösung, ließ einen weiterrackern. Nevada kannte diesen Gott nur aus dem Religionsunterricht in der Schule, den sie auch nur so lange besucht hatte, bis der Schulleitung bekannt wurde, dass ihre Eltern aus der Kirche ausgetreten waren. Dann war Nevada, zusammen mit vielen anderen in ihrer Klasse, vom Religionsunterricht befreit worden. Das wenige, das sie gelernt hatte, ließ sie vermuten, dass Gott weiblich war, eine gnadenlose Mutter wie ihre eigene.
Sie wusste, dass es noch etwas anderes geben musste. Sie dachte an die wilden Geschichten über Hindu-Gottheiten, die gern zur Yogalehre erzählt wurden, als sei Yoga Teil des hinduistischen Glaubens. Diese Götter waren unbeherrscht und fehlerhaft, sie richteten Unheil an, ebenso selbstverständlich, wie sie Rettung leisteten. Patanjali definierte Gott als eine übergeordnete Größe, ein übergeordnetes Bewusstsein. Etwas, das immer da war. Darunter hatte Nevada sich nie viel vorstellen können. Noch fremder war ihr die Vorstellung, dass Gott überall sei, also auch in ihr. Zum Glück war die absolute Hingabe an Gott nur eine Möglichkeit, um den Zustand Yoga zu erreichen. Die andere war anstrengender, aber vertrauter: Üben. Das konnte Nevada. Sie winkte die Kellnerin heran.
«So, habt ihr etwas gefunden?»
«Ja», sagte Nevada. «Ich nehme das Cordon bleu mit Pommes frites. Und ein Glas Rotwein.»
«Und was darf es für Sie sein?»
«Für mich?» Martha klappte die Speisekarte zu. «Für mich bitte dasselbe.»
Üben und Loslassen, genau genommen. So stand es in dem
Weitere Kostenlose Bücher