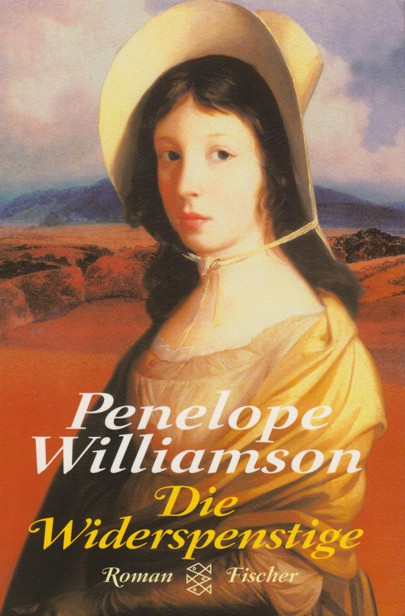![Penelope Williamson]()
Penelope Williamson
zusah, wie sein
Sohn trank, regten sich Neid und fast so etwas wie Eifersucht in ihm.
Caleb wurde dunkelrot, als er feststellte, daß Elizabeth nicht
mehr auf den Kopf ihres Sohnes blickte, sondern ihn ansah. Der Anflug eines
nachsichtigen Lächelns umspielte ihren Mund, aber in ihrem Blick lag auch
Zärtlichkeit. Caleb hatte diesen Blick noch nie gesehen, und das verwirrte ihn
ebenfalls.
»Du hast mir noch nicht verraten, wie dir dein Sohn gefällt«, sagte
Elizabeth.
Im Feuerschein sah das blonde Haar des Säuglings aus wie ein
Taufhäubchen aus gesponnenem Gold. Die dicken roten Bäckchen spannten und
entspannten sich beim Trinken. Caleb überlegte, was Elizabeth dabei empfand,
wenn an ihrer Brustwarze so kräftig gesaugt wurde. Bereitete das wirklich, wie
Tyl behauptet hatte, einer Frau Genuß?
»Er ist ein schönes Kind«, sagte Caleb schließlich ehrfürchtig.
Ihm war irgendwie die Kehle zugeschnürt. »Aber ich fühle mich seltsam. Ich
werde noch nicht ganz damit fertig, daß es mein Kind ist. Mein Sohn. Um
dir die Wahrheit zu sagen, das alles macht mir ein bißchen Angst.«
»So ist es mir am Anfang auch gegangen«,
erwiderte Elizabeth ruhig, ohne jede Angst. Es war seltsam, aber Caleb hatte
Mühe, diese ruhige, selbstsichere Frau mit der Elizabeth in Verbindung zu
bringen, die von den Wilden gefangengenommen worden war und dort ihr Kind zur
Welt gebracht hatte. In den vergangenen Monaten hatte ihn immer wieder die
Vorstellung gequält, was die Indianer ihr alles antun würden. Die Elizabeth,
die nun zu ihm zurückgekehrt war, kam ihm jedenfalls fast wie eine Fremde vor.
Caleb beugte sich vor und betrachtete seine Hände, die gefaltet
auf seinen Knien lagen. Er schluckte und fuhr sich mit der Zungenspitze über
die trockenen Lippen.
»Lizzie? Haben sie ... haben sie dich gut
behandelt?«
Elizabeth blickte in die Ferne, und ihr
Gesicht wurde ausdruckslos. »Am Anfang war es ...« Sie schauderte und
erschreckte damit Ezekiel, der einen empörten Schrei ausstieß. Sie legte ihn an
die andere Brust. »Aber daran erinnere ich mich kaum. Nachts habe ich
allerdings noch manchmal Alpträume.«
Sie nahm das Kind auf den Schoß, beugte sich vor und strich ihm
über die gefalteten Hände. »Es war nicht deine Schuld, Caleb.«
»Aber ich habe dich hierher gebracht. So etwas
wäre dir in Boston niemals passiert.« Er umklammerte ihre Hand und ließ sie
nicht mehr los. Er blickte auf und sah ihr tief bewegt ins Gesicht. »Ich sage
Oberst Bishop morgen, daß er einen anderen suchen muß. Ich bringe dich nach
Hause, Liebes.«
»Ich bin zu Hause. Hier ist deine Gemeinde, Caleb. Du gehörst
hierher.« Sie lächelte sanft. »'Da wo du hingehst, will auch ich hingehen'.«
»Aber die Bedrohung durch die Indianer ist nicht vorbei. Es kann
weitere Überfälle geben ...«
Sie entzog ihm die Hand und legte ihm die Finger auf den Mund.
»Ich glaube, ich habe keine Angst mehr, Caleb. Keine solche dumme Angst.
Vielleicht liegt es daran, daß ich das erlebt habe, was meinen Befürchtungen
entsprach, und daß ich es überlebt habe.«
Er biß sich heftig auf die Unterlippe und schloß die Augen. »Wenn
ich daran denke ... du in den Händen dieser Wilden ...«
Ezekiels Kopf sank von der Brust. Elizabeth stand auf, wiegte ihn
in den Armen und wartete geduldig, bis er ein Bäuerchen machte, dann legte sie
ihn in die Krippe, die Caleb von Obadia Kemble im Winter hatte anfertigen
lassen. Die Seiten waren mit geschnitzten Blumen verziert, Kopfteil und Fußteil
schmückten eine Sonne und ein Mond. Die Krippe war für den Reverend wie ein
Talisman der Hoffnung gewesen, ein Beweis seines Glaubens, daß Gott seine Frau
mit dem Kind sicher zu ihm zurückbringen werde.
»Die Abenaki sind keine Wilden«, sagte Elizabeth. »Gewiß, sie
können grausam zu denen sein, die ihre Feinde sind. Aber das können wir auch.«
Sie stand im Schatten, und deshalb konnte er
ihr Gesicht nicht sehen, aber er hörte den Anflug von Zorn in ihrer Stimme. »Sind
Schandpfähle und Galgen etwa nicht brutal und grausam? Und wir sind diejenigen,
die das Skalpieren eingeführt haben. Wir, Engländer und Franzosen, mit unseren
unsinnigen, verheerenden Kriegen, die wir um ein Land führen, das uns
rechtmäßig überhaupt nicht gehört. Frag jeden beliebigen Mann in Merrymeeting,
und er wird dir sagen, daß die Abenaki 'ausgerottet' werden müssen, damit wir
in Frieden unsere Felder bestellen und die Bäume fällen können. Dabei haben die
Indianer in diesem Land,
Weitere Kostenlose Bücher