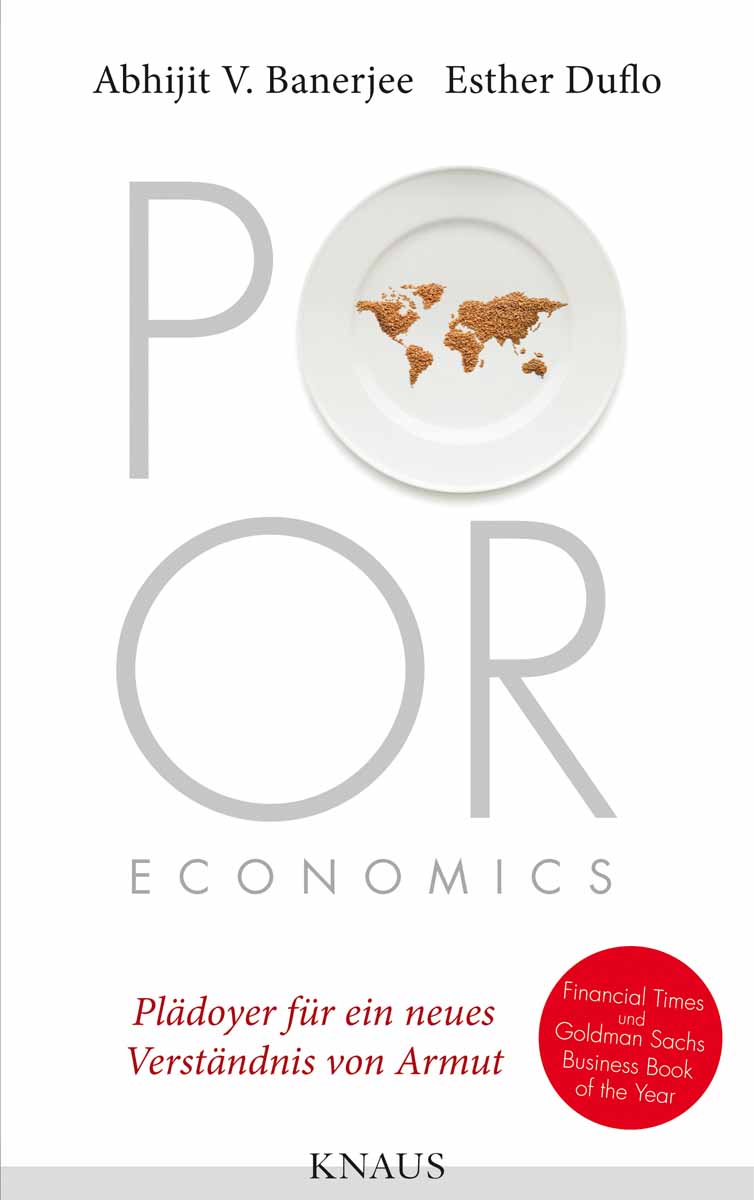![Poor Economics]()
Poor Economics
dass viele Arbeiter auf Delhis Baustellen aus Malda kamen, und sie wusste, dass es mit der Baubranche in Delhi abwärts ging. Also reisten wir von Dorf zu Dorf und befragten die jungen Männer dort nach ihren Erfahrungen.
Jeder kannte jemanden, der weggegangen war. Von den Wanderarbeitern selbst waren viele zu Hause, weil gerade Muharram war, der erste Monat des islamischen Kalenders. Alle berichteten uns höchst bereitwillig von ihren Erlebnissen. Mütter erzählten uns von den fernen Städten im Süden oder im Norden Indiens, Orte wie Ludhiana (Punjab), Coimbatore (Tamil Nadu) und Vadodara (Gujarat), wo ihre Söhne und Enkel nun lebten und arbeiteten. Wir hörten auch tragische Geschichten: Eine Frau erzählte uns von ihrem Sohn, der in Delhi an einer mysteriösen Krankheit gestorben war, und dennoch klang ihre Stimme euphorisch. »Gibt es Arbeit in der Stadt?«, fragte Sengupta wieder und wieder. Ja, viel Arbeit. »Habt ihr etwas gehört, dass die Jobs weniger werden?« Nein, in Mumbai ist alles prima. Und so weiter. Wir gingen zur Bahnstation, um nachzusehen, ob jemand nach Hause kam, weil er seinen Job verloren hatte. Am Bahnhof trafen wir drei junge Männer, die gerade nach Mumbai fahren wollten. Einer von ihnen war noch nie dort gewesen, die beiden anderen, »Veteranen«,
versicherten ihm, es sei überhaupt kein Problem, dort einen Job zu finden. Das Ende vom Lied: Somini Sengupta schrieb keine Geschichte darüber, wie die Armen unter der globalen Krise litten.
Der springende Punkt ist nicht, dass während der Krise in Mumbai weniger Baustellenjobs angeboten wurden – das war sicher der Fall –, doch für die meisten dieser jungen Männer ging es zunächst nur darum, überhaupt eine Chance zu haben. Es gab immer noch Jobs, und zwar solche, in denen sie doppelt so viel Geld am Tag verdienen konnten wie in ihrem Dorf. Verglichen mit der Situation zu Hause – die ständige Angst, keine Arbeit zu bekommen, das scheinbar endlose Warten auf die Regenzeit – kam ihnen das Leben als wandernder Bauarbeiter noch ziemlich attraktiv vor.
Natürlich hat die globale Krise auch die Unsicherheiten für die Armen vergrößert, aber eben nur minimal angesichts der Risiken, mit denen sie Tag für Tag leben müssen, auch dann wenn es keine Krise gibt, die der Weltbank Sorgen bereitet. 1998, während der indonesischen Krise, verlor die Rupie 75 Prozent ihres Wertes, Lebensmittelpreise stiegen um 250 Prozent und das Bruttoinlandsprodukt fiel um 12 Prozent, aber für die Reisbauern, die in der Regel zu den ärmsten Leuten gehören, erhöhte sich in dieser Zeit die Kaufkraft. 6 Am schlimmsten traf es die Staatsbediensteten und andere Menschen mit festem Einkommen. Selbst in den Jahren der großen Finanzkrise in Thailand (1997/1998), als die Wirtschaft um 10 Prozent schrumpfte, gaben zwei Drittel von 1 000 Befragten an, der Hauptgrund für ihr gesunkenes Einkommen sei die Dürre. 7 Nur 26 Prozent nannten den Verlust des Arbeitsplatzes, und mit ziemlicher Sicherheit waren nicht alle Arbeitsplatzverluste Folge dieser Krise. Auch hier hat man wieder den Eindruck, dass es für die Armen nicht viel schlechter lief als sonst, und zwar genau deshalb, weil es ihnen auch schon unter normalen Umständen ziemlich schlecht geht. Sie haben mit Problemen zu kämpfen, die sie nur allzu gut kennen. Für die Armen ist das Gefühl, sich inmitten einer gigantischen Finanzkrise zu befinden, ein Dauerzustand.
Aber das Leben der Armen birgt nicht nur mehr Risiken als das von weniger Armen, vergleichbare Schicksalsschläge haben für sie meist auch stärkere Auswirkungen. Erstens sind Einschnitte beim Konsum für jemanden, der sowieso schon wenig konsumiert, wesentlich schmerzlicher. Wenn ein nicht ganz so armer Haushalt sein Konsumverhalten einschränken muss, verzichtet die Familie vielleicht auf ein paar Handyeinheiten, kauft seltener Fleisch oder schickt die Kinder auf eine weniger teure Schule. Das tut natürlich weh. Aber für Arme bedeutet ein hoher Einkommensverlust unter Umständen tiefe Einschnitte bei den Ausgaben für Grundbedürfnisse: Im vergangenen Jahr mussten die Erwachsenen in 45 Prozent der extrem armen Haushalte, die wir im ländlichen Udaipur-Distrikt befragten, zeitweise ihre Mahlzeiten verkleinern. Und das ist etwas, das sie äußerst ungern tun. Interviewpartner, die ihre Mahlzeiten hatten verkleinern müssen, beschrieben sich selbst als sehr viel unglücklicher als andere, die das nicht tun mussten.
Abbildung 3:
Weitere Kostenlose Bücher