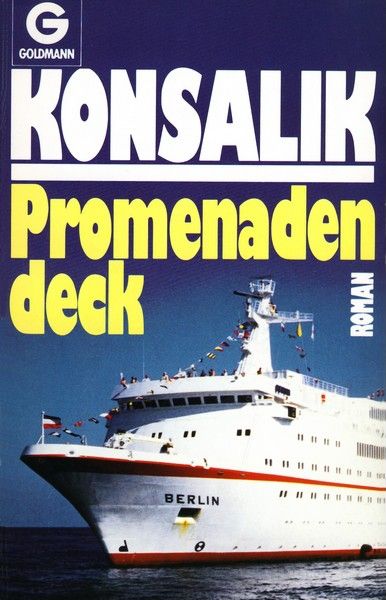![Promenadendeck]()
Promenadendeck
Faultiere im Gezweig, klappern die Papageien und steigen in Schwärmen die Kolibris, Pelikane und Kormorane auf … ein feuchtheißes Paradies, in dem 31° Tagestemperatur nie unterschritten werden. In den Nebenflüssen des Rio Guayas wühlen sich die Wasserschweine in den Sumpfboden, lauern Alligatoren auf ihre Beute und wimmelt es von den gefräßigen, gefürchteten Piranhas, die in wenigen Minuten ein in den Fluß gestürztes Schwein bis zum Skelett abnagen können. Entlang der Ufer schlingen sich Lianen und Orchideen an den Bäumen empor, blühen die Bromelien und steigt die verdunstende Feuchtigkeit wie Nebel aus den üppigen Mangrovensümpfen.
Durch diese herrliche, aber auch gefährliche Zauberwelt fährt man hindurch zur Stadt Guayaquil. Von der ›Costa‹ mit ihren weiten, fruchtbaren Schwemmlandebenen, die Ecuador zum größten Bananenerzeuger auf dem Weltmarkt gemacht haben, kann man bei gutem Wetter das andere Land sehen: die Gebirgskette der Anden, die ›Sierra‹, die auf einer Länge von 650 km das ganze Land durchzieht, gekrönt von den weißen Gletschergipfeln des 6.267 m hohen Chimborazo und des noch tätigen Vulkans Cotopaxi, mit 5.897 m der höchste noch nicht erloschene Vulkan der Welt. Um sie herum eine Kette von erloschenen Vulkanen, mit Eiskappen und ewigem Schnee, hineinragend in einen unwahrscheinlichen blauen Himmel. Berg- und Nebelwälder ziehen sich an den Gebirgsflanken empor, und hier, im Osten, wo sich die Cordillere zum flachen Amazonastiefland absenkt, beginnt der tropische Urwald, nur bewohnt von wenigen, wie Nomaden herumziehenden Urwaldindianern.
Erst im mittleren Hochland, wo Mais, Weizen, Kartoffeln, Gemüse und Obst gedeihen, wo Rinder- und Schweinezucht eingeführt wurden, sind die Indianer seßhaft geworden: die Stammesgruppe der Quechua-Indianer, reinblütige Nachkommen der sagenhaften Inkas.
Guayaquil.
Das heißt auch: Bischofssitz mit der wundervollen Kathedrale, die berühmte Kirche Santo Domingo in der Altstadt Las Penas, breite Avenuen und Parks, das Denkmal der südamerikanischen Freiheitshelden José de San Martin und Simon Bolívar. Vor allem aber ein kleines Weltwunder von überwältigender Schönheit: der Marmorfriedhof. Hier steht man stumm und bewundernd vor Hunderten von kleinen Grabestempeln oder Fingern aus weißem Marmor, vor bildhauerischen Monumenten voll allegorischer Ausdruckskraft und vor Tausenden von Grabkammern, hineingehauen in weiße Marmorwände, drei-, vierstöckig übereinander … eine einmalige Luxusstadt der Toten.
Reiche Südamerikaner aus allen Ländern, aber auch US-Amerikaner und Europäer haben, ergriffen von diesem Marmorfriedhof, in ihren Testamenten bestimmt, hier unter einem nur für sie aus dem Marmor gehauenen Monument die letzte Ruhe zu finden. Und so geht man vorbei an den herrlichen Grabmälern und liest Namen aus aller Welt, bleibt vor dem riesigen Christus an der Stirnseite des Friedhofes stehen, dessen segnende Hände alle umfassen, und begreift plötzlich, daß diese Stätte ein Symbol des Glaubens, der Demut und des Hoffens ist, ein marmornes Gedenken an die Unsterblichkeit.
Vor der langen Mauer des Friedhofs, auf dem breiten Gehsteig der Straße, sitzen die Indios oder Mestizen und bieten den Besuchern Blumen an. Riesige Kränze und Gebinde in allen Farben, mit großen Bändern und Schleifen verziert, kunstvolle Gestecke und grellbunte Sträuße … und das alles aus Papierblumen und Kunststoffstengeln, in Heimarbeit gefertigt oder von Papierblumenfabriken geliefert.
Guayaquil.
Das ist mehr als ein Hafen; das ist das Monument unvergessener Jahrhunderte.
So ähnlich erklärte Juan de Garcia die Stadt, als er mit Thea Sassenholtz, aus Panama kommend, auf dem Airport von Guayaquil landete. Sie waren über die Urwälder und die oberen Amazonasflüsse geflogen, bei einem so klaren Wetter, daß man meinte, man könne in die Baumwipfel der Urwaldriesen greifen. Ein paarmal überflogen sie einsame Indianersiedlungen, in den unendlichen Regenwald hineingeschlagene, gerodete Lebensräume, meist an einem Flußlauf, der den Eingeborenen das Leben sicherte: Fische, mit Giftpfeilen aus Blasrohren erlegtes Wild, das zum Fluß kam, um zu trinken, und wilder Mais.
»Da unten gibt es Indiosiedlungen, die noch kein Weißer entdeckt, geschweige denn betreten hat«, sagte Juan de Garcia. »Den Wald kann bei diesen Entfernungen keiner durchdringen. Die Indios würden jeden sofort töten, enthaupten und den Kopf schrumpfen lassen, um
Weitere Kostenlose Bücher