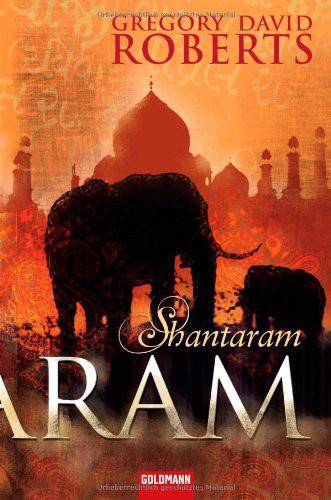![Shantaram]()
Shantaram
Tür meiner Hütte setzten der kurzen Phase der Stille und des Alleinseins ein Ende, die ich genossen hatte, nachdem meine Freunde und Nachbarn Kano und den Bärenführern gefolgt waren. Ohne auf eine Antwort zu warten, trat Naresh ein und grüßte mich.
»Hallo, Linbaba«, sagte er auf Englisch. »Alle erzählen, du umarmst es Bären.«
»Hallo, Naresh. Wie geht’s deinem Arm? Soll ich mal einen Blick drauf werfen?«
»Gern, wenn du Zeit hast«, antwortete er, nun in seiner Muttersprache Marathi. »Ich mache gerade Pause und muss in fünfzehn bis zwanzig Minuten wieder bei der Arbeit sein. Wenn du zu tun hast, kann ich auch ein andermal kommen.«
»Nein, ist schon okay. Komm, setz dich, dann sehe ich es mir an.«
Nareshs Oberarm war mit einem Rasiermesser aufgeschlitzt worden. Die Wunde war nicht tief und hätte mit einem einfachen Verband schnell heilen müssen, doch die Feuchtigkeit und der Schmutz bei Nareshs Arbeit steigerten das Infektionsrisiko. Der Verband, den ich ihm erst vor zwei Tagen angelegt hatte, war dreckig und schweißgetränkt. Ich nahm ihm die schmutzige Binde ab und packte sie in eine Plastiktüte, um sie später in einem der Gemeinschaftsfeuer zu verbrennen.
Das Fleisch begann bereits wieder zusammenzuwachsen, doch die Wunde war rot und entzündet und wies gelblich weiße Eiterstellen auf. Khaderbhais Leprakranke hatten mir einen Zehnliterkanister Desinfektionsmittel besorgt. Ich wusch mir damit die Hände und säuberte dann die Wunde, schabte sie aus, bis nichts mehr von dem bakteriellen Wundbelag zu sehen war. Das tat mit Sicherheit weh, doch Naresh ertrug die Schmerzen mit ausdrucksloser Miene. Als die Wunde trocken war, streute ich etwas antibiotischen Puder in den Schnitt und legte einen neuen Verband an.
»Prabaker hat mir erzählt, dass du neulich abends nur knapp der Polizei entkommen bist, Naresh«, sagte ich mehr schlecht als recht in meinem gebrochenen Marathi, während ich ihn verarztete.
»Prabaker hat die enttäuschende Angewohnheit, immer nur die Wahrheit zu erzählen.« Naresh verzog das Gesicht.
»Wem sagst du das!«, erwiderte ich, und wir mussten beide lachen.
Wie die meisten Marathen freute sich auch Naresh darüber, dass ich mich bemühte, seine Sprache zu lernen, und wie die meisten anderen sprach er langsam und sehr deutlich, um mir das Verstehen zu erleichtern. Ich sah keine Parallelen zwischen Marathi und Englisch, keine Ähnlichkeiten und vertraut erscheinenden Wörter wie bei Englisch und Deutsch oder Englisch und Italienisch. Trotzdem war die Sprache relativ leicht zu lernen, denn die Marathen waren begeisterte und sehr gute Lehrer.
»Wenn du weiter mit Aseef und seiner Bande stehlen gehst«, sagte ich in ernsterem Ton, »wirst du irgendwann erwischt.«
»Ich weiß schon, ja, und ich hoffe, dass der Erleuchtete auf meiner Seite ist. Ich bete auch immer, dass mir nichts passiert. Weil ich ja nicht für mich selbst stehle, sondern für meine Schwester, weißt du. Sie heiratet bald, und wir haben nicht genug Geld für die versprochene Mitgift. Es ist meine Verantwortung. Ich bin der älteste Sohn.«
Naresh war tapfer, intelligent und fleißig und ging sehr liebevoll mit kleinen Kindern um. Seine Hütte war kaum größer als meine, doch er teilte sie mit seinen Eltern und sechs Geschwistern. Er schlief draußen auf dem unebenen Boden, damit die Jüngeren drinnen mehr Platz hatten. Ich hatte ihn mehrmals in der Hütte besucht und wusste, dass sein gesamtes Hab und Gut in eine Plastiktüte passte: ein Satz schlichte Kleidung zum Wechseln, eine gute Hose und ein Hemd für offizielle Anlässe oder den Tempelbesuch. Ein Buch mit buddhistischen Versen, einige Fotos und ein paar Toilettenartikel. Sonst besaß Naresh nichts. Er gab jede Rupie, die er verdiente oder klaute, seiner Mutter und ließ sich von ihr nur ein wenig Geld geben, wenn er es unbedingt brauchte. Er trank nicht, rauchte nicht und spielte nicht. Als mittelloser Mann ohne irgendwelche Zukunftsaussichten hatte er keine Freundin und auch nur geringe Chancen, eine zu finden. Die einzige Unterhaltung, die er sich gönnte, bestand darin, einmal die Woche zusammen mit seinen Arbeitskollegen in das billigste Kino der Stadt zu gehen. Dennoch war er ein fröhlicher und optimistischer junger Mann. Manchmal, wenn ich spätabends durch den Slum nach Hause ging, sah ich ihn zusammengerollt auf dem Boden schlafen, und ein erschöpftes Lächeln lag auf seinem schmalen Jungengesicht.
»Und du, Naresh?«, fragte
Weitere Kostenlose Bücher