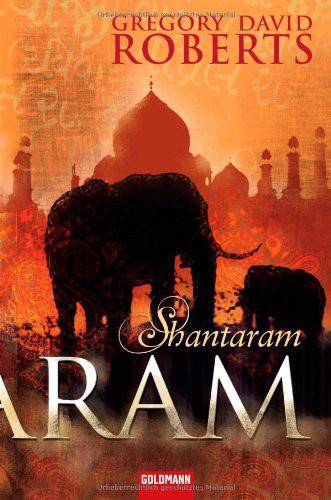![Shantaram]()
Shantaram
wollte, sondern weil das vom Thema ablenkte und die Zigaretten ein wenig Wärme abstrahlten.
»Was denkst du dann, wenn du nicht sprichst?«, fragte Khader und nahm das zweite Beedie entgegen, nachdem er die Kippe des ersten weggeworfen hatte.
»Gebete sind das wohl eher nicht. Ich denke an bestimmte Menschen. Meine Mutter … und meine Tochter. Ich denke an Abdullah … und Prabaker – ich habe dir von ihm erzählt, der Freund, der umgekommen ist. Ich erinnere mich an Freunde, an Menschen, die ich liebe.«
»Du denkst an deine Mutter. Auch an deinen Vater?«
»Nein.«
Ich hatte die Frage schnell beantwortet – zu schnell vielleicht –, und ich spürte, wie Khader mich eingehend betrachtete.
»Ist dein Vater noch am Leben, Lin?«
»Ich glaube schon. Aber ich … weiß es nicht genau. Und es ist mir so oder so egal.«
»Dein Vater sollte dir aber wichtig sein«, erklärte er und wandte den Blick ab. Ich empfand diese Ermahnung damals als anmaßend; Khader wusste schließlich nichts über meinen Vater und meine Beziehung zu ihm. Ich war so verfangen in Vorwürfen, alten und neuen, dass mir die Schwermut in seiner Stimme entging. Ich machte mir damals nicht bewusst, dass auch er ein Sohn im Exil war, der über seinen Vater sprach.
»Du bist mehr wie ein Vater für mich, als er es jemals war«, sagte ich, und obwohl ich das so empfand, obwohl ich Khader mein Herz öffnete, klang meine Stimme mürrisch und fast gehässig.
»Sag so etwas nicht!«, erwiderte er aufgebracht und starrte mich an. Ich hatte ihn noch nie zuvor so unbeherrscht erlebt und zuckte unwillkürlich zusammen ob dieser Heftigkeit. Sein Gesicht entspannte sich sofort wieder, und er legte mir die Hand auf die Schulter. »Was ist mit Träumen? Was träumst du hier?«
»Träume?«
»Ja. Erzähl mir von deinen Träumen.«
»Ich träume nicht oft«, antwortete ich und versuchte mich zu erinnern. »Es ist merkwürdig, weißt du, aber ich hatte lange Zeit immer Albträume – seit meiner Flucht aus dem Gefängnis. In den Albträumen wurde ich gefasst oder wehrte mich dagegen. Aber seit wir hier oben in den Bergen sind – ich weiß nicht, ob es wegen der dünnen Luft ist oder weil ich immer so erschöpft und ausgefroren bin, wenn ich einschlafe, oder weil ich besorgt bin wegen des Krieges –, aber jedenfalls hatte ich hier noch keinen einzigen Albtraum. Eher ein paar schöne Träume.«
»Erzähl weiter.«
Das wollte ich aber nicht; ich hatte von Karla geträumt.
»Einfach … schöne Träume, über die Liebe.«
»Gut«, murmelte er, nickte ein paar Mal und löste die Hand von meiner Schulter. Er schien zufrieden zu sein mit meiner Antwort, aber seine Miene war düster, fast grimmig. »Ich träume hier auch. Ich habe vom Propheten geträumt. Wir Muslime dürfen es eigentlich niemandem erzählen, wenn wir vom Propheten träumen. Es ist gut, es ist wunderbar, und die Gläubigen erleben es immer wieder, aber es ist uns verboten, unsere Träume preiszugeben.«
»Warum?«, fragte ich fröstelnd.
»Weil es streng verboten ist, das Gesicht des Propheten zu beschreiben oder über ihn zu sprechen als eine Person, die man sehen kann. Das war der Wunsch des Propheten selbst, damit niemand ihn anbetet und Gott aus diesem Grund weniger huldigt. Deshalb gibt es keine Abbilder des Propheten – keine Zeichnungen oder Gemälde oder Statuen. Aber ich habe von ihm geträumt. Und ich bin kein wirklich guter Muslim, nicht wahr? Weil ich dir von meinem Traum erzähle. Der Prophet war zu Fuß irgendwohin unterwegs. Ich ritt hinter ihm auf meinem Pferd – einem wunderschönen weißen Pferd –, und obwohl ich sein Gesicht nicht erkennen konnte, wusste ich doch, dass er es war. Ich stieg von meinem Pferd und übergab es ihm, wobei ich die ganze Zeit das Gesicht gesenkt hielt, aus Achtung vor ihm. Doch zuletzt hob ich den Blick und sah ihn davonreiten in den Sonnenuntergang. Das war mein Traum.«
Seine Stimme klang ruhig, doch ich kannte Khader gut genug, um den bedrückten Ausdruck in seinen Augen zu erkennen. Und da war noch etwas, etwas so Neues und Fremdes, dass es ein paar Momente dauerte, bis ich es zu deuten vermochte: Furcht. Abdel Khader Khan fürchtete sich, und als ich das erkannte, überlief auch mich ein Angstschauer. Das war unvorstellbar. Bis zu diesem Augenblick war ich der festen Überzeugung gewesen, dass Khaderbhai sich niemals fürchtete. Besorgt und zutiefst beunruhigt, wechselte ich abrupt das Thema.
»Khaderji, ich weiß, ich wechsle das
Weitere Kostenlose Bücher