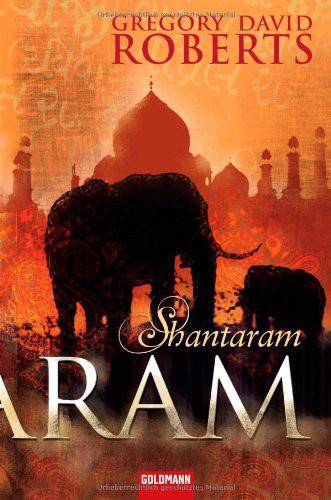![Shantaram]()
Shantaram
Geist denselben Weg gegangen war.
»Lin! Lin, wo bist du?«
»Hier drin, Didier!«, schrie ich zurück. »Auf dem Dachboden! Du bist ganz in der Nähe! Kannst du mich hören?«
»Ja!«, rief er. »Bin sofort bei dir!«
»Sei vorsichtig!«, rief ich warnend. »Hier sind zwei Typen, und … Scheiße, Mann, die sind nicht nett!«
Ich hörte Didiers Schritte. Er stolperte im Dunkeln und fluchte laut. Dann stieß er die schmale Tür auf und kam herein, eine Pistole im Anschlag. Ich war ausgesprochen erfreut über seinen Anblick. Rasch sah er sich um und erfasste die Szene: die blutverschmierten Zwillinge, das Blut auf meinem Gesicht und den Armen, die teilnahmslose Gestalt auf dem thronartigen Stuhl. Als er den Schock verdaut hatte, verengte er grimmig die Augen. In diesem Moment ertönte der Schrei.
Rajans Bruder stürmte mit markerschütterndem Schrei auf Didier zu, der, ohne zu zögern, auf den Mann zielte und ihm in den Unterleib schoss. Er stieß ein Schmerzensgeheul aus, stürzte zu Boden und krümmte sich. Rajan selbst schleppte sich zu dem Stuhl und stellte sich, barbrüstig wie er war, schützend vor Madame Zhou. Didier stierte er nun mit demselben Hass an wie zuvor mich, und wir wussten beide, dass er bereit war, sich für diese Frau erschießen zu lassen. Didier trat einen Schritt vor und richtete die Pistole auf Rajans Herz. Didiers Stirn war angestrengt in Falten gelegt, doch die hellen Augen des Franzosen strahlten Ruhe und kalte beherrschte Überlegenheit aus. In diesem Moment kam der wahre Didier Levy zum Vorschein: die Stahlklinge, die für gewöhnlich in der schäbigen rostigen Scheide verborgen war. Didier Levy: einer der fähigsten, gefährlichsten Männer von Bombay.
»Willst du es tun?«, fragte er mit steinerner Miene.
»Nein.«
»Nein?«, fragte er erstaunt, ohne Rajan aus den Augen zu lassen. »Schau dich doch an, Lin. Schau, was sie dir angetan haben. Du solltest sie erschießen.«
»Nein.«
»Zumindest verwunden.«
»Nein.«
»Es ist gefährlich, sie am Leben zu lassen. Deine Geschichte mit diesen Leuten hier ist … sehr unerfreulich.«
»Ist schon okay«, murmelte ich.
»Du solltest wenigstens einen von beiden erschießen, non ?«
»Nein.«
»Nun gut. Dann werde ich sie für dich erschießen.«
»Nein«, sagte ich wieder. Ich war Didier dankbar, dass er rechtzeitig erschienen war, um die beiden davon abzuhalten, mich umzubringen. Noch dankbarer war ich ihm aber dafür, dass er mich davor bewahrt hatte, die beiden Männer zu töten. Übelkeit und Erleichterung brachen in Wellen über mich herein und schwemmten die Wut davon. Ich zitterte, als das letzte Lächeln der Scham in meinen Augen verwehte. »Ich will sie nicht erschießen … und ich will auch nicht, dass du sie erschießt. Ich wollte gar nicht mit ihnen kämpfen und hätte es auch nicht getan, wenn sie mich nicht angegriffen hätten. Sie tun nur, was ich auch tun würde, wenn ich diese Frau lieben würde. Sie beschützen sie. Sie haben nichts gegen mich. Es geht um sie. Lass sie in Ruhe.«
»Und was soll nun mit ihr geschehen?«
»Du hattest recht«, sagte ich leise. »Sie ist erledigt. Sie ist quasi tot. Tut mir leid, dass ich nicht auf dich gehört habe. Ich … musste es wohl mit eigenen Augen sehen.«
Ich streckte die Hand aus und legte sie auf die Pistole. Rajan zuckte zusammen und krümmte sich. Sein Bruder schrie auf und rutschte an der Wand entlang. Dann drückte ich die Pistole langsam nach unten, bis sie zum Boden zeigte. Rajan starrte mich an, und Erleichterung zeichnete sich in seinen dunklen Augen ab. Dann humpelte er zu seinem Bruder.
Ich ging Didier voran durch den Geheimgang zu der verkohlten Treppe.
»Ich bin dir echt was schuldig, Didier«, sagte ich und grinste im Dunkeln vor mich hin.
»Kann man wohl sagen«, erwiderte Didier, und in diesem Moment brach die Treppe unter uns ein, und wir stürzten durch die verbrannten Stufen ins Leere und trafen im Erdgeschoss hart auf dem Boden auf.
Wir waren von einer Wolke aus Staub und Fasern umgeben und husteten und spuckten. Ich versuchte mich unter meinem Freund hervorzuwinden, der auf mir gelandet war. Mein Hals war steif und wund, und ich hatte mir bei dem Aufprall Handgelenk und Schulter verstaucht, schien aber ansonsten intakt zu sein. Didier gab etwas von sich, das wie ein ärgerliches Stöhnen klang.
»Bist du okay?«, fragte ich. »Herrgott, war das ein Sturz. Alles in Ordnung, Mann?«
»Es reicht«, knurrte Didier erbost. »Ich geh jetzt
Weitere Kostenlose Bücher