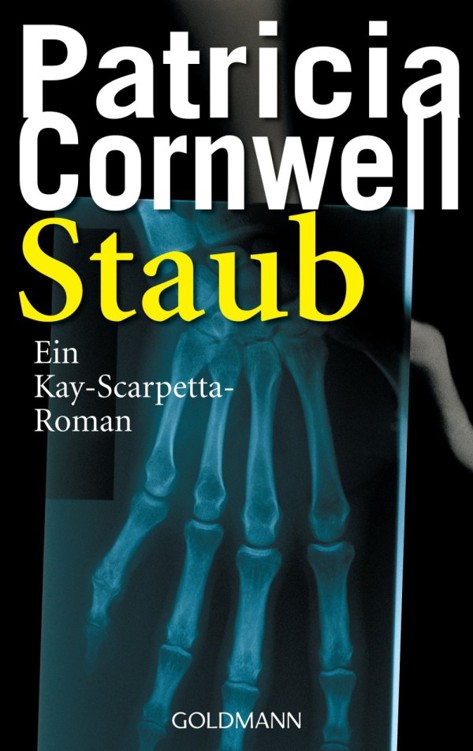![Staub]()
Staub
zwischen uns lief.«
»Uns?«
»Suz und mir. Paare tun manchmal solche Dinge.«
»War sonst noch jemand dabei? Haben auch andere Leute mitgespielt?«
»Alles fand in meinem Privathaus statt.«
»Was sind Sie bloß für ein Schwein!«, sagt Lucy bedrohlich. »So widerliches Zeug in Gegenwart eines kleinen Mädchens zu treiben.«
»Sind Sie vom FBI?« Als er die Augen öffnet, sind sie stumpf vor Hass und erinnern an die Augen eines Hais. »Ich liege doch richtig, oder? Ich hätte mir denken können, dass so etwas irgendwann passieren wird. Als ob mein Privatleben etwas mit dieser Sache zu tun hätte. Offenbar will mich jemand reinlegen.«
»Ich verstehe. Das FBI hat Sie also gezwungen, von mir zu verlangen, dass ich mich für eine ganz alltägliche flugärztliche Untersuchung ausziehe.«
»Das hat nichts damit zu tun. Es spielt keine Rolle.«
»Da bin ich aber anderer Ansicht«, höhnt sie. »Es spielt sehr wohl eine Rolle. Und zwar eine ziemlich große, wie Sie gleich herausfinden werden. Allerdings bin ich nicht vom FBI, Pech gehabt.«
»Geht es um Gilly?« Inzwischen ist seine Sitzhaltung etwas lockerer. Er bewegt sich kaum und scheint sich mit seinem Schicksal abgefunden zu haben. »Ich habe meine Tochter geliebt. Seit Thanksgiving habe ich sie nicht gesehen, und das ist, bei Gott, die Wahrheit.«
»Der Hund«, gibt Benton ihr ein neues Stichwort. Lucy überlegt ernsthaft, ob sie sich den Empfänger aus dem Ohr reißen soll.
»Glauben Sie, jemand hat Ihre Tochter umgebracht, weil Sie für den Heimatschutz spionieren?« Lucy weiß zwar, dass dem nicht so ist, aber irgendwie muss sie ihn ja kriegen. »Kommen Sie, Frank. Raus mit der Wahrheit! Machen Sie es nicht noch schlimmer für sich.«
»Jemand hat sie umgebracht?«, wiederholt er. »Das kann nicht sein.«
»Es ist aber so.«
»Unmöglich.«
»Wer war bei den Spielchen in Ihrem Haus sonst noch dabei?
Kennen Sie einen gewissen Edgar Allan Pogue? Das ist der Typ, der in Mrs. Arnettes früherem Haus wohnt.«
»Mrs. Arnette kannte ich«, erwidert er. »Sie war meine Patientin. Hypochondrisch veranlagt und eine ziemliche Nervensäge.«
»Das ist wichtig«, sagt Benton, als ob Lucy das nicht selbst wüsste. »Er vertraut sich dir an. Sei seine Freundin.«
»Ihre Patientin in Richmond?«, fragt Lucy ihn. Obwohl sie nicht die geringste Lust hat, seine Freundin zu mimen, ist ihr Tonfall versöhnlicher, und sie gibt sich interessiert. »Wann?«
»Wann? O Gott, vor einer Ewigkeit. Ich habe unser Haus in Richmond von ihr gekauft. Sie besaß einige Häuser. Um die Jahrhundertwende gehörte ihrer Familie ein ganzer Straßenzug. Es war ein riesiges Grundstück, das irgendwann unter den Familienmitgliedern aufgeteilt und später verkauft wurde. Unser Haus war ein richtiges Schnäppchen. Wenn ich nur gewusst hätte, was ich mir dadurch einhandelte.«
»Klingt, als hätten Sie sie nicht sehr gemocht«, erwidert Lucy. Sie tut, als würden sie und Dr. Paulsson sich wunderbar vertragen; so als hätte er sie nicht erst vor ein paar Minuten sexuell belästigt.
»Ständig kam sie zu mir nach Hause oder in die Praxis, um zu jammern. Sie war eine Landplage.«
»Was ist aus ihr geworden?«
»Sie ist gestorben. Vor acht oder zehn Jahren. Lange her.«
»Woran?«, will Lucy wissen.
»Sie litt schon seit einer Weile an Krebs. Sie ist zu Hause gestorben.«
»Einzelheiten«, sagt Benton.
»Was wissen Sie darüber?«, fragt Lucy. »War sie allein, als sie starb? Hatte sie eine große Beerdigung?«
»Warum wollen Sie das alles wissen?« Dr. Paulsson sitzt auf seinem Stuhl und blickt sie an. Doch er fühlt sich sichtlich besser, weil sie freundlich zu ihm ist.
»Es könnte etwas mit Gilly zu tun haben. Ich weiß mehr als Sie, also lassen Sie mich meine Fragen stellen.«
»Vorsicht«, warnt Benton. »Verärgere ihn nicht.«
»Tja, dann fragen Sie«, meint Dr. Paulsson spöttisch.
»Waren Sie auf der Beerdigung?«
»Ich kann mich nicht erinnern, dass eine stattgefunden hätte.«
»Sie muss doch beerdigt worden sein«, beharrt Lucy.
»Sie hat Gott gehasst und ihn für ihre Schmerzen und Leiden verantwortlich gemacht. Auch dafür, dass es niemand lange in ihrer Nähe aushielt, was Sie verstehen könnten, wenn Sie sie gekannt hätten. Eine unangenehme alte Frau. Einfach unerträglich. Ärzte verdienen nicht genug, um sich mit Patientinnen wie ihr herumzuärgern.«
»Und sie ist zu Hause gestorben? Sie hatte Krebs und ist allein zu Hause gestorben?«, wundert sich
Weitere Kostenlose Bücher