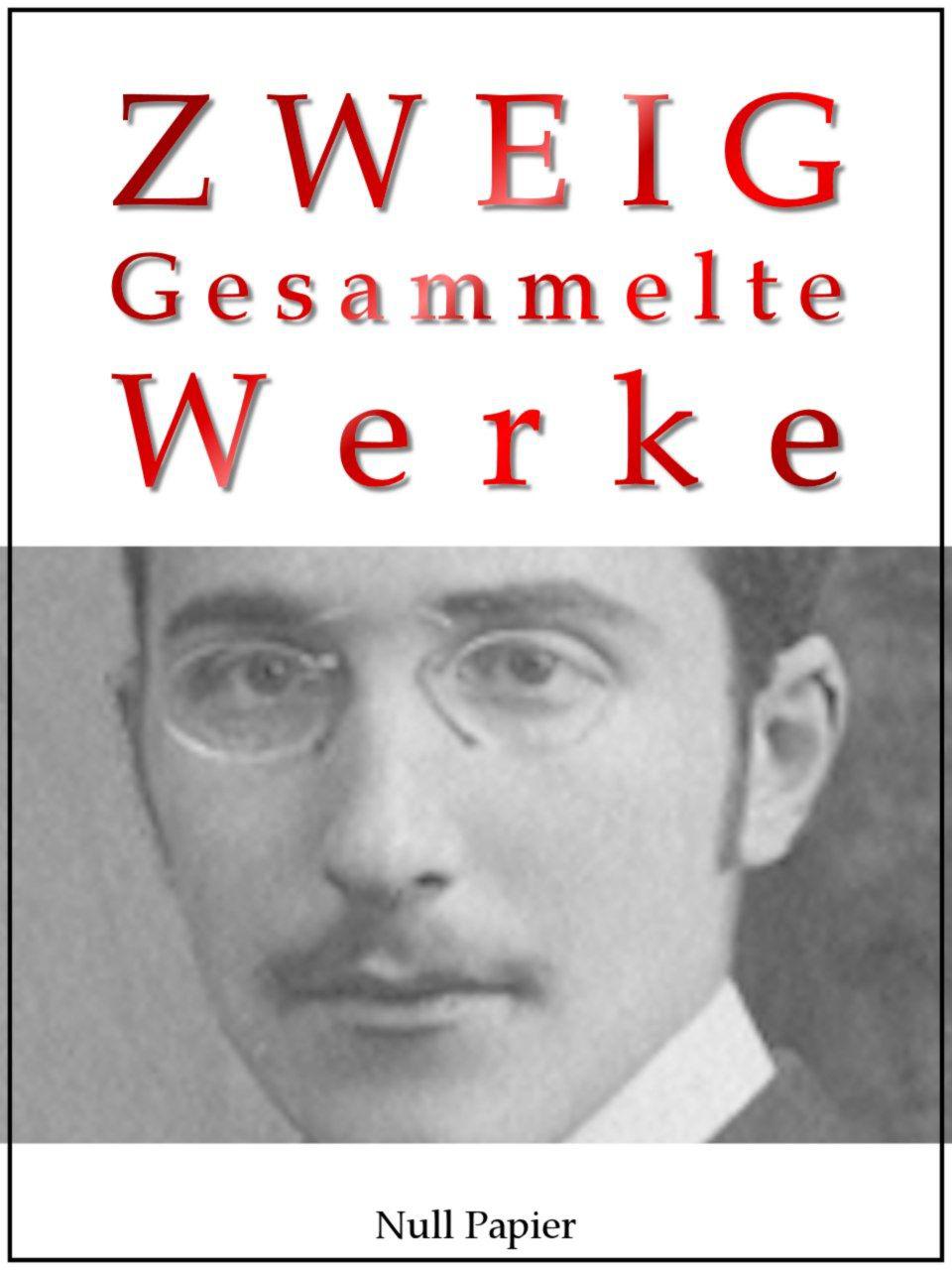![Stefan Zweig - Gesammelte Werke]()
Stefan Zweig - Gesammelte Werke
Tänzerin zu halten wie einst, mangelt das Geld: man wird langsam alt. Mißmutig trottet er durch den Novemberregen seiner Hausung in der Rue Richelieu zu; was tut’s, wenn die Kleider beschmutzt werden, noch ist der Schneider nicht bezahlt. Überhaupt, er seufzt tief, das Beste im Leben ist vorbei, man sollte eigentlich ein Ende machen. Unwirsch klettert er (auch das Atmen wird jetzt schon seinem Kurzhals manchmal schwer) die Treppe hinauf ins oberste Stockwerk, zündet das Licht an, blättert in Papieren und Rechnungen. Triste Bilanz! Aufgezehrt das Vermögen, die Bücher tragen nichts, von »Amour« sind jetzt nach Jahren glatt siebenundzwanzig Exemplare verkauft (»Man möchte es ein heiliges Buch nennen, weil kein Mensch daran zu rühren wagt«, hatte ihm gestern sein Verleger zynisch gesagt). So bleiben fünf Franken Rente am Tag, vielleicht viel für einen hübschen frischen Jungen, aber erbärmlich wenig für einen dickleibigen älteren Herrn, der die Frauen und die Freiheit liebt. Am besten, man machte Schluß. Henri Beyle nimmt einen Foliobogen und schreibt zum viertenmal in diesem melancholischen Monat sein Testament: »Ich Unterzeichneter vermache meinem Vetter Romain Colomb, was ich in meinem Hotel, 71, Rue Richelieu, besitze. Ich wünsche direkt auf den Friedhof übergeführt zu werden, die Kosten meines Begräbnisses sollen nicht mehr als dreißig Francs ausmachen.« Und als Nachschrift noch: »Ich bitte Romain Colomb um Verzeihung für alle Unannehmlichkeiten, die ich ihm bereite, und ich ersuche vor allem, nicht traurig zu sein wegen dieses unvermeidlichen Vorfalls.«
»Wegen dieses unvermeidlichen Vorfalls« – morgen werden die Freunde die vorsichtige Phrase verstehen, wenn man sie herrufen wird und die Kugel statt im Armeerevolver zwischen den Gehirnknochen steckt. Aber glücklicherweise ist Henri Beyle heute müde, er wartet noch einen Tag mit dem Selbstmord, und am nächsten Morgen kommen die Freunde und heitern ihn auf. Beim Herumstreifen im Zimmer sieht einer ein weißes Folioblatt auf dem Tisch. »Julien« überschrieben. Was das bedeutet, fragt er neugierig; ach, er wollte einen Roman schreiben, antwortet Stendhal. Sie sind sehr begeistert, die Freunde, sprechen dem Melancholischen Mut zu, und wirklich, er beginnt mit dem Werke. Der Titel »Julien« wird gestrichen und ersetzt durch einen, der später unsterblich wird, durch »Le Rouge et le Noir«. Tatsächlich, seit jenem Tag ist es mit Henri Beyle zu Ende, ein anderer hat begonnen für ewige Dauer: er heißt Stendhal.
1831, Civitavecchia. Neue Verwandlung.
Kanonenboote geben feierlich eine Salve, Wimpel wehen eilfertig Salut, da jetzt ein dickleibiger Herr in der pomphaften französischen Diplomatenuniform aus dem Dampfer steigt. Respekt! – dieser Herr, gestickte Weste, galonierte Hose, ist der Konsul von Frankreich, Herr Henri Beyle. Wieder einmal hat ihm ein Umsturz in den Sattel geholfen, wie einstmals der Krieg, jetzt die Julirevolution. Nun lohnt es sich, Liberaler gewesen zu sein, unentwegte Opposition getrieben zu haben gegen die dummen Bourbonen: dank emsiger Frauenfürsprache ist man sofort zum Konsul ernannt worden im geliebten Süden, eigentlich in Triest, aber leider hat Herr von Metternich dort den Verfasser ärgerlicher Bücher nicht für wünschenswert erklärt und das Visum verweigert. So hat man, weniger erfreulich, in Civitavecchia Frankreich zu vertreten, aber immerhin, es ist Italien, und man bekommt fünfzehntausend Franken Gehalt.
Muß man sich schämen, nicht gleich zu wissen, wo Civitavecchia auf der Landkarte liegt? Durchaus nicht: von allen italienischen Städten wohl das erbärmlichste Nest, ein kalkweißer böser Brutkessel, in dem afrikanische Hitze ihr Fieber kocht, ein enger versandeter Hafen aus altrömischen Segelschiffstagen, eine ausgemergelte Stadt, öde, langweilig und leer, »man krepiert vor Langeweile«. Am besten gefällt Henri Beyle an dieser Deportiertenstation die Landstraße nach Rom, weil sie nur siebzehn Meilen lang ist, und Herr Beyle entschließt sich sofort, sie häufiger zu nützen als seine Würden. Eigentlich sollte er arbeiten, Berichte felbern, Diplomatie treiben, auf seinem Posten sitzen, aber die Esel im Auswärtigen Amt lesen seine Exposés ja gar nicht, wozu Geist an diese Sitzkünstler verschwenden – so pelzt man lieber alle Akten dem Schuft Lysimachus Caftangliu Tavernier auf, seinem Unterbeamten, einem bösartigen Biest, das ihn haßt und dem er die Ehrenlegion
Weitere Kostenlose Bücher