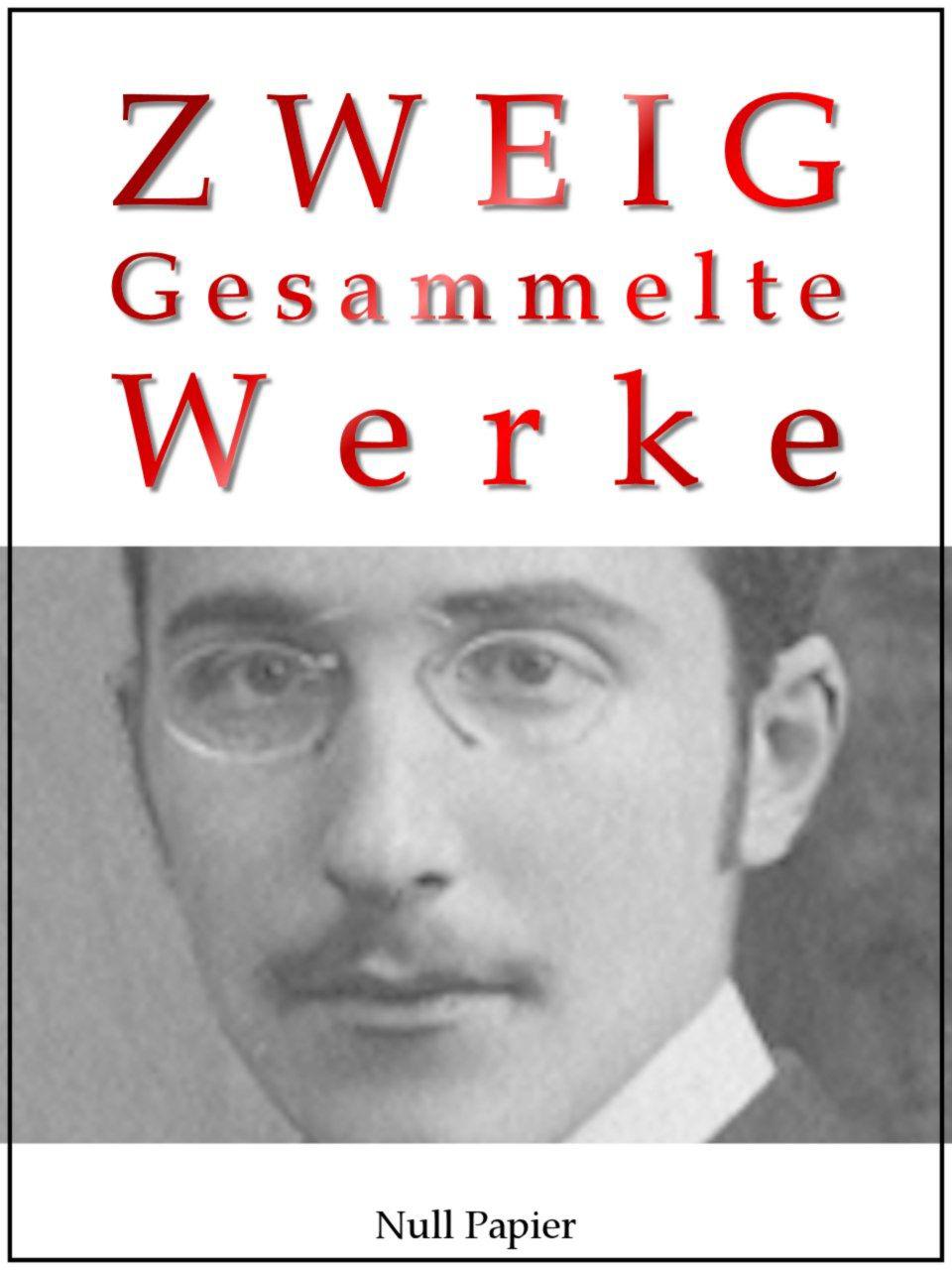![Stefan Zweig - Gesammelte Werke]()
Stefan Zweig - Gesammelte Werke
Hallstatt – Hall meint immer Salz – gefördert wurde, wußten schon die Römer, und sie erkannten mit ihrem ausgezeichneten strategischen Blick sofort die wunderbare geographische Lage Salzburgs und machten es zu ihrem Kastell Juvavum. Noch heute findet man bei fast jedem Hausumbruch römische Steine oder Vasentrümmer. Dann kamen die Erzbischöfe als Herren, die Kriege nicht liebten und deren Neigung die Kunst war. Prächtige Kirchen zu bauen und weiträumige Paläste, schöne Gärten, Springbrunnen und Wasserspiele war ihre Leidenschaft, sie bestellten italienische Baumeister, italienische Musiker und ließen sich, reich wie sie waren, in prächtiger Fülle alles ausstatten; und dank ihrer klugen Politik, die der Stadt jedweden Krieg ersparte, ist ihr Werk eigentlich unverändert erhalten geblieben, und wer, besonders abends, über die Straßen und Plätze geht, kann sich vollkommen und restlos der Illusion hingeben, im fünfzehnten oder sechzehnten Jahrhundert zu sein, denn im inneren Kreise der eigentlichen Altstadt steht kaum ein einziges Haus, das jünger wäre als dreihundert Jahre, und wo Modernisierungen sich als notwendig erweisen, werden sie ziemlich behutsam im Stile der Vergangenheit durchgeführt.
Das alles macht nun Salzburg zu einer geheimnisvollen und kaum vergleichbaren Doppelwelt. Es ist eine uralte, eine antiquierte Stadt und im Sommer doch die lebendigste, kulturellste von Europa. Da schwemmen zu den Festspielen die großen Luxuszüge die reichsten, die bekanntesten, die berühmtesten, die neugierigsten Menschen Europas heran, und Salzburg ist für zwei Monate die europäischeste Hauptstadt der Musik, des Theaters und der Literatur. Dann ist man mitten im zwanzigsten Jahrhundert und fünfzig Schritte weiter liegt ein stiller Kirchhof, unberührt seit fünfhundert Jahren, schlafendes Mittelalter, und ohne daß man es weiß, gerät man aus der Landschaft in die Stadt, aus der Stadt in die Landschaft hinein. Alleen heben mitten an in Wiesen um ein uraltes Schloß, und plötzlich werden sie Straßen und ihre Bäume erstarren zu steinernen Wänden. Und anderseits blühen mitten im Weichbild in Höfen breite Gärten auf, die niemand kennt, von oben nach unten, von den Bergen, von den Hügeln ins Tal schaffen Villen und kleine Schlösser den Übergang. Allerorten ist der harte Übergang vermieden, die Landschaft dringt milde in die Stadt, und die Stadt wieder löst sich fächerhaft ins Freie; das Alte gliedert sich dem Neuen, das Großstädtische dem Antiquierten, Norden und Süden, Gebirge und Tal söhnen sich in dieser Stadt freundlich aus.
Diese Kunst des harmonischen Übergangs ist das Wunderbare und gleichzeitig das eminent Musikalische der Stadt. Wie andere Städte versteht Salzburg in Stein und Stimmung tönend zu lösen, was sich sonst in der Wirklichkeit grob widerspricht. Und dieses Geheimnis, diese Lösung von Dissonanzen in Harmonie hat sie von der Musik gelernt. Man muß nicht erst auf Mozarts Heimathaus hindeuten, um zu bekräftigen, wie eminent musikalisch sie wirkt, und es ist wahrhaftig kein Zufall, daß gerade der heiterste, der beweglichste, der anpassungsfähigste, der beschwingteste aller Musiker hier geboren war, und wenn in der Landschaft die Größe und Strenge der Form, so findet er in den Lustgärten, in dem verschnörkelten Barock der Bischofsbauten jene architektonische Melodik der Stadt, er hat sie in einer andern Kunst zur ewigen Harmonie erhoben. Wie eine solche Stadt wird, ist so schwer zu erklären wie die Geburt eines Kunstwerkes, und es bleibt gleichgültig zu fragen, wer eigentlich diese besonders künstlerische Tönung – die übrigens auch das dumpfe Ohr hier vernimmt – dieser Stadt zugedacht hat. Ob es die Erzbischöfe waren, die reichen, kunstfreudigen und kunstgelehrten, oder ob der Zauber der Landschaft, ob die italienischen Baumeister oder die besondere Konstellation der Zeit: das Letzte eines Zaubers bleibt immer unerklärbar. Wie manche Menschen überschwebt eben auch manche Stätten der Genius der Musik, um ihrer steinernen Hülle eine besondere Schwingung zu geben. Salzburg hat die Gnade gehabt, nicht für Wehr und Krieg gebaut zu werden wie die meisten deutschen Städte, eng zusammengedrückt in einen Gürtel von Mauern – immer war der Stimme ihrer Seele ein Raum frei, immer konnte sie singen und schwingen, ein tönendes Instrument, das festliche und heitere Lebensstunden lobsingen wollte. Plätze waren ihr gebaut für Umgänge und Prozessionen,
Weitere Kostenlose Bücher