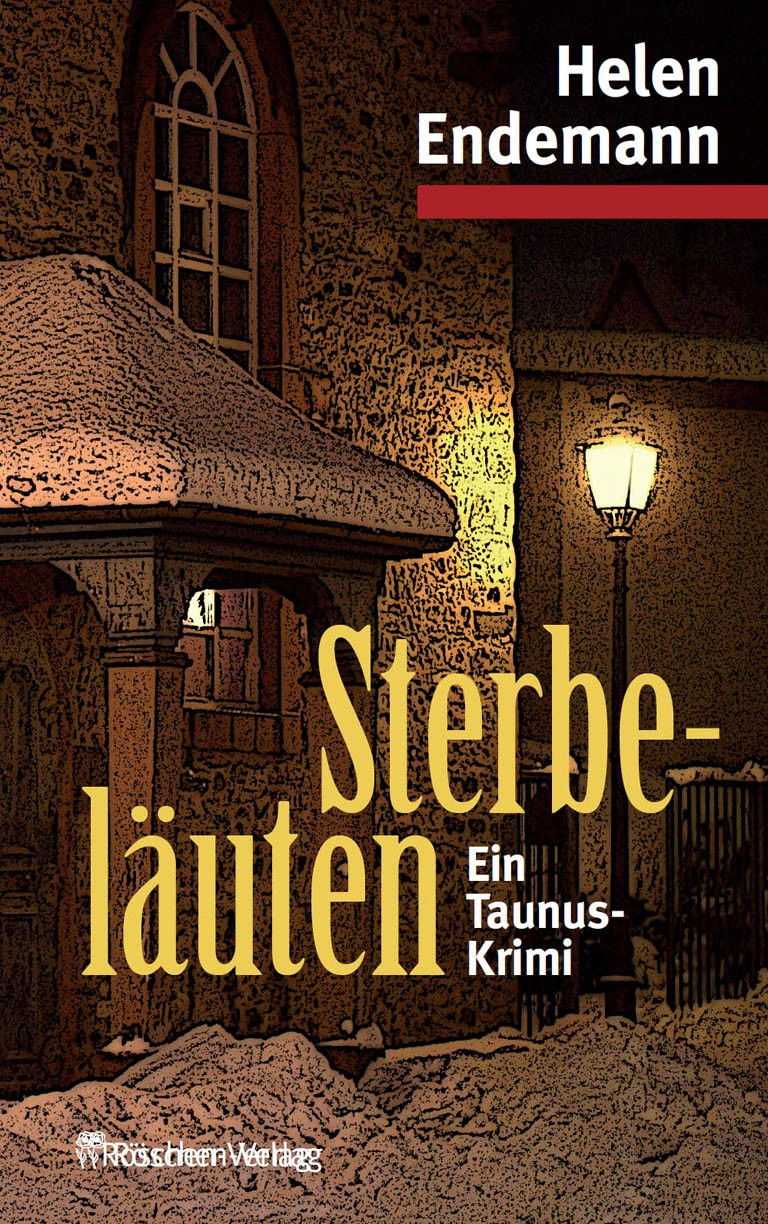![Sterbelaeuten]()
Sterbelaeuten
Frau Heinemann nicht verstanden hatte. Es schien ihr wichtig gewesen zu sein, aber er hatte sich keinen rechten Reim aus ihren Worten machen können.
Elisabeth schüttelte den Kopf. „Wie alt ist Sibylles Tochter jetzt? Sie müsste so fünfzehn oder sechzehn sein.“ Elisabeth wusste, dass Sibylle geschieden war. Sie war sehr jung schwanger geworden und hatte den Vater geheiratet. Einen jungen Mann aus Hamburg. Dort lebte sie mit ihm und der gemeinsamen Tochter. Aber es hatte wohl nicht funktioniert. Vor vier Jahren war sie zurückgekommen und wieder bei ihrer Mutter eingezogen.
„Keine Ahnung.“ Henry starrte abwesend ins Leere.
Elisabeth füllte zwei Tassen mit Kaffee und stellte Henry eine hin. „Ich erinnere mich, dass sie zwölf war, als Sibylle ging“, überlegte sie laut. „Das Gericht hat die Tochter gefragt, bei wem sie bleiben wollte, und sie hat den Vater gewählt. Wohl wegen der Schule und der Freunde. Arme Sibylle, arme Tochter.“
Henry schien nur mit Anstrengung aus seiner Gedankenwelt zurückzukehren. „Entschuldige, ich bin abgedriftet.“ Er nahm einen Schluck aus seiner Kaffeetasse. „Ja, merkwürdig ist das schon, eine Mutter, die wieder bei ihrer Mutter einzieht.“
„Stephanie dagegen ist ja nie ausgezogen“, sagte Elisabeth.
„Warum eigentlich, verdienen tut sie doch sicher genug als Anwältin“, wunderte sich Henry.
„Sie hat mir mal erzählt, dass sie in ihren ersten Berufsjahren praktisch dauernd im Ausland war, auf Projekten ihrer Mandanten“, erzählte Elisabeth. „Da hätte sich eine eigene Wohnung gar nicht gelohnt. Vielleicht hat sie gedacht, sie zieht aus, wenn sie einen Freund hat. Aber der Richtige ist wohl bisher nicht vorbeigekommen.“
„Jedenfalls scheinen sie ja gut miteinander auszukommen, die drei. Ich meine, sie sind wohl gut miteinander ausgekommen“, stellte Henry fest.
„Na ja, sie mussten zusammenhalten, nachdem der Heinemann Senior so früh gestorben war.“ Elisabeth sah auf die Uhr. „Ich muss an die Arbeit. Und du? Legst du dich ’ne Runde hin?“
„Ach nee“, sagte Henry, „darauf warten die Bonifatius-Pilger ja nur.“
Henry hatte eine gewisse Paranoia entwickelt. Die Sulzbacher Kirche war eine wichtige Station auf dem Bonifatiusweg und gelegentlich klingelten Wanderer, die sich die Kirche ansehen wollten, im Pfarrhaus. Manchmal wollten sie auch aufs Klo. An einem Montagmorgen im Advent war ein Anschlag der Bonifatius-Pilger auf Henrys Vormittagsschläfchen aber unwahrscheinlich. Elisabeth würde ihr Geld viel eher auf den Postboten oder das Schulsekretariat setzen.
–
An dem Nachmittag, an dem Joska Maté am Flughafen „gerettet“ hatte, führte er ihn zu einem alten Fiat. Sie ließen den Flughafen hinter sich und – wie es Maté schien – damit auch die Zivilisation, wie er sie kannte. Maté hatte mit seinen Eltern in Deutschland in einer kleinen Hochhaussiedlung in einem Vorort von Köln gewohnt. Das waren graue Betonklötze mit fünfzehn Stockwerken, schweren Metalltüren, beschmierten Wänden und nach Pisse stinkenden Fahrstühlen. Aber die Plattenbauten, in deren Richtung Joska den Fiat lenkte, übertrafen Matés Vorstellungen bei weitem. Eine Plattenbausiedlung an der anderen, so weit das Auge reichte. Die schönen braunen Häuser, die er vom Flugzeug aus gesehen hatte und die ihn an Bilder von Wien erinnerten, mussten jenseits des Flusses liegen.
„Neu-Belgrad“, sagte Joska, und Maté war es, als schwinge Stolz in der Stimme seines Retters. „Du bist ein Rom, nicht?“
Die Frage traf Maté unerwartet. Ja, seine Eltern waren Roma. Sie waren 1991 aus dem Kosovo nach Belgrad geflohen. Dort kam Maté zur Welt und kurz darauf ergatterte Matés Vater eine Gelegenheit, mit der jungen Familie nach Deutschland zu fahren, in einem LKW, auf der Ladefläche. Dort beantragten die Eltern Asyl, bekamen aber nur die Duldung. In Matés Alltag in Deutschland hatte es keine Rolle gespielt, dass seine Eltern Roma waren, und niemand hätte ihn so plump darauf angesprochen. Seine Eltern hatten mit ihm albanisch gesprochen und wenn jemand fragte, dann sagten sie: „Wir sind Albaner.“ Bis sein Vater Krebs bekam und starb, hatte Maté keine Ahnung gehabt, dass man ihn und seine Mutter aus Deutschland abschieben konnte. Dass sie in Deutschland nur „geduldet“ waren, zuerst wegen der unsicheren Lage im Kosovo und dann seinetwegen, weil er noch nicht volljährig war. Und dass man die Roma im Kosovo ausgerechnet mit seinem
Weitere Kostenlose Bücher