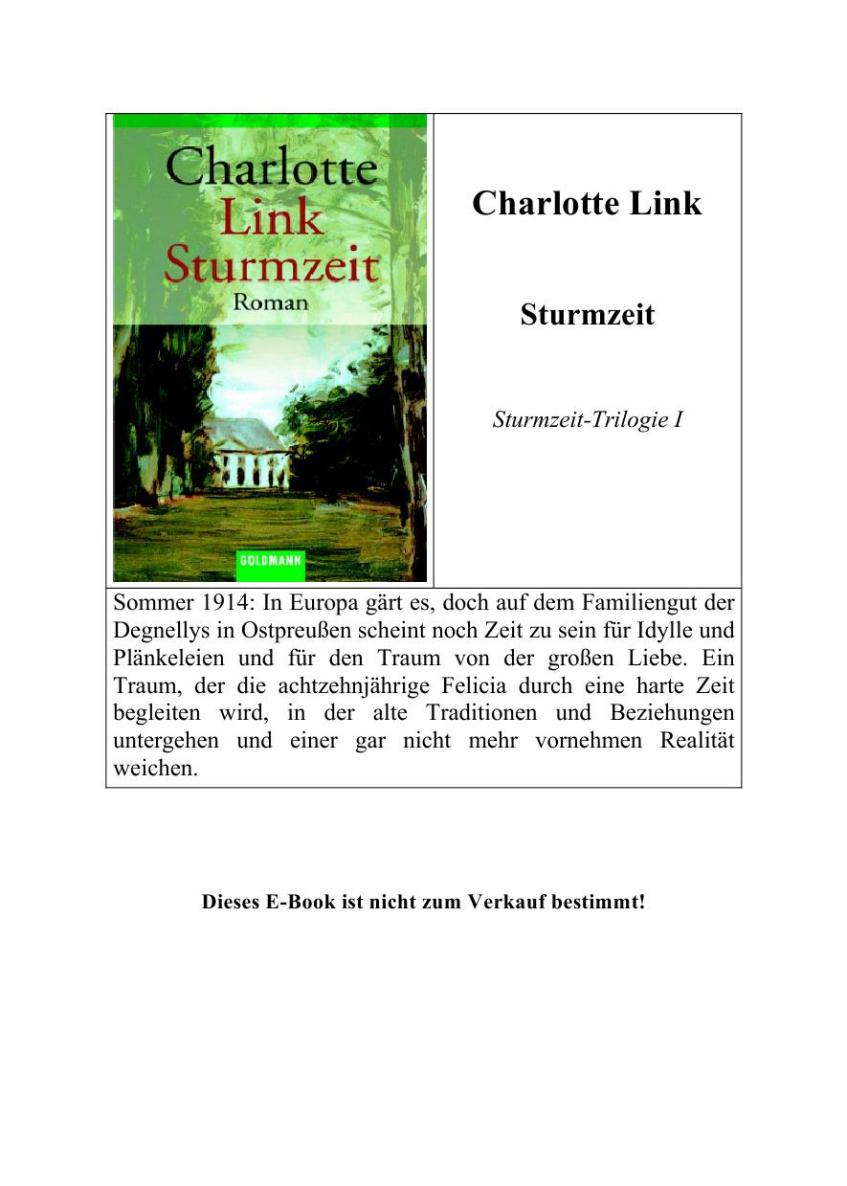![Sturmzeit]()
Sturmzeit
die sie bestürmten, nur ein einziges Bild deutlich sehen - ein Bild, das sich in ihr Denken einbrannte und für alles stand, was verloren und vergangen war: ein blonder und ein dunkler Junge, die barfuß über eine Sommerwiese kamen und lachten, als sei das Leben ein Spiel und Glück ein unwandelbares Gut.
Im Januar verschärfte sich die Lage in Berlin. Die Stimmung der Menschen konnte nicht tiefer sinken. Es herrschte strenger Frost, und da Kohlen kaum mehr zu bekommen waren, sprangen Grippe-und Keuchhustenepidemien durch die Stadt. Die Leute erfroren beinahe in den Schlangen vor den Lebensmittelgeschäften, und da das Berliner Temperament nicht gerade zum stillen Dulden befähigt, wurde lautstark räsoniert. Zur Hölle mit dem Krieg! Man wollte Frieden. Die Sozialisten riefen zum Widerstand auf, und Tausende folgten ihnen. Es kam zu Massenstreiks und täglich zu Demonstrationen. Berlin brodelte.
Felicia gewöhnte sich daran, alle Wege zu Fuß zu machen, da kaum mehr eine Straßenbahn fuhr. Sie hortete Kerzen, da es leicht passieren konnte, daß abends urplötzlich das elektrische Licht erlosch oder gleich den ganzen Tag über nicht brannte, und mit den Essensmarken jagte sie von Geschäft zu Geschäft. Da sie jung und hübsch war, rückte mancher Händler heraus, was er eigentlich hatte zurückhalten wollen. Was wußten die schon, wieviel Anstrengung es sie kostete, ihr Gesicht zu einem Lächeln zu verziehen, wie hart sie jedes ihrer schmeichelnden Worte kalkulierte. Einmal stand sie eine ganze Nacht mit einem Handkarren um Kohlen an. Obwohl es schneite, kamen mit jeder Stunde mehr Menschen hinzu. In Lumpen gehüllte alte Frauen, die nicht mehr stehen konnten, kauerten zusammengesunken auf ihren Wägelchen, rachitische Kinder drängten sich wie die Hühner zusammen, um ein wenig Wärme zu finden. Ein geschäftstüchtiger Zeitgenosse baute einen Stand auf, an dem er Glühwein feilbot. Gegen Mitternacht war Felicia überzeugt, innerhalb der nächsten Stunde den Kältetod zu sterben, wenn sie nicht sofort auch solch einen Glühwein bekäme. Da sie es nicht wagte, ihren mühsam erstandenen Platz zu verlassen, schickte sie ein Kind mit einem Geldstück weg, aber weder das Kind noch das Geld sah sie je wieder.
Sie kroch am nächsten Morgen buchstäblich durch die Straßen, vor Kälte bis in die Zehenspitzen empfindungslos geworden, aber stolze Besitzerin eines halben Zentners Kohle, den sie auf dem Karren hinter sich herzog, bereit, jeden Menschen anzufallen, der es auf ihre Beute abgesehen hatte. Als sie zu Hause ankam, quälten sich die anderen gerade aus ihren warmen Betten, jammerten über Kälte und Hunger. Felicia sehnte sich nach einem heißen Bad, doch es stellte sich heraus, daß die Wasserwerke an diesem Tag streikten und man an den Hähnen drehen konnte, soviel man wollte, es kam kein Tropfen.
»Wir haben kein Brot mehr«, klagte Linda, »und Paul hat solchen Hunger!«
Felicia entriß ihr mit einer heftigen Bewegung die Brotmarken. »Gib her! Ich weiß, wo ich noch welches kriegen kann. Aber wenn heute noch einer von euch jammert, dem kratz'ich die Augen aus!« Sie verließ die Wohnung, gefolgt von verstörten Blicken. Es hatte ihr doch keiner etwas getan!
Anfang Februar war Felicia sicher, schwanger zu sein. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie immer noch versucht, sich etwas vorzumachen und harmlose Erklärungen für eindeutige Indizien zu finden, aber schließlich konnte sie nicht länger die Augen vor den Tatsachen verschließen. Sie raffte sich auf und ging zu einem Arzt.
Die Diagnose war eindeutig.
»Sie sind Anfang des dritten Monats«, sagte der Arzt,»herzlichen Glückwunsch. Soweit ich feststellen kann, ist alles in Ordnung, aber Sie müßten mehr auf Ihre Ernährung achten und unnötige Anstrengungen vermeiden. Ich weiß, das ist schwierig in diesen Zeiten.«
»Ja«, murmelte Felicia, die still auf ihrem Stuhl kauerte. Ihre Gedanken jagten sich. Nicht, daß sie nicht gerne ein Kind von Maksim gehabt hätte, aber wie, um Himmels willen, sollte sie das erklären? Sie und Alex hatten einander seit über zwei Jahren nicht gesehen; nicht einmal der naiven Sara würde man das erklären können. Was würde Elsa sagen? Und vor allem - wie sollte sie Alex jemals wieder gegenübertreten?
Der Arzt, dem ihr Mienenspiel nicht entgangen war, bemerkte: »Es gibt doch keine Schwierigkeiten bei Ihnen?«
»Nein..., nur fragt man sich natürlich, ob es richtig ist, ein Kind mitten im Krieg zu
Weitere Kostenlose Bücher