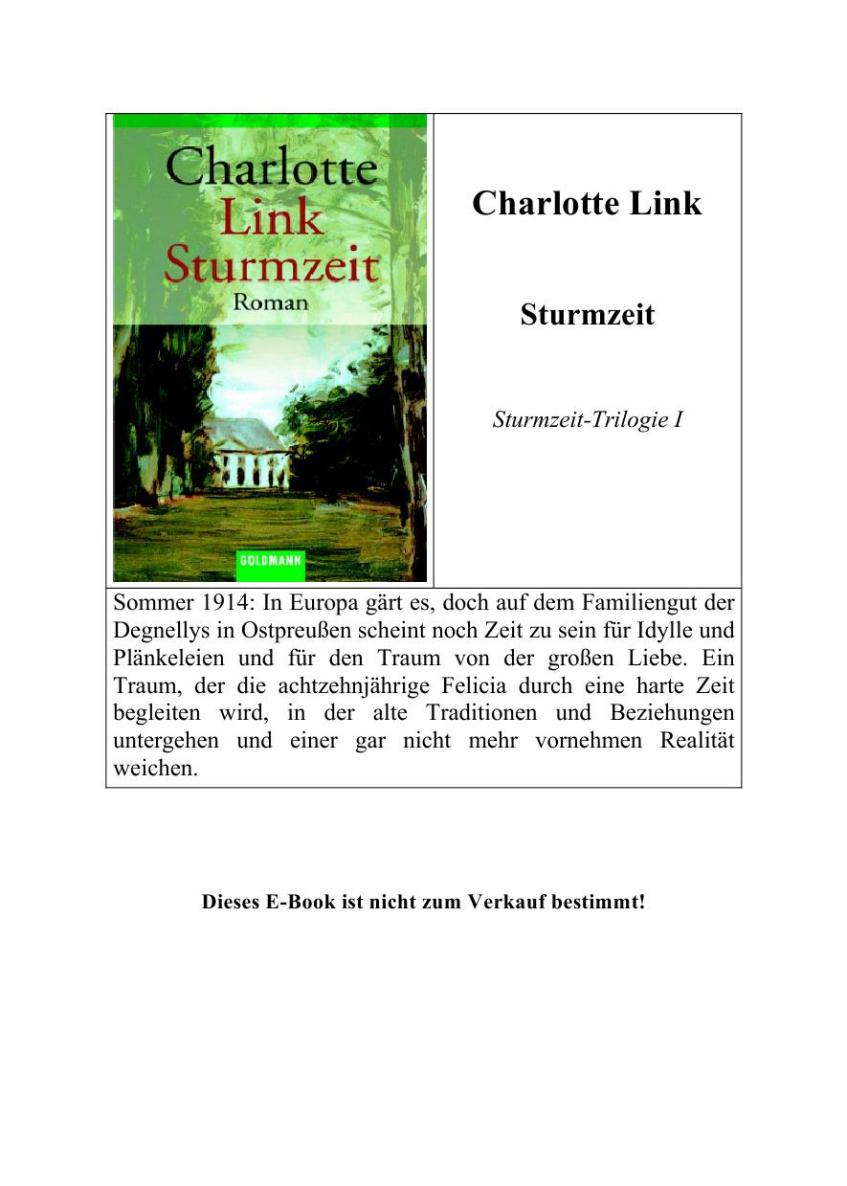![Sturmzeit]()
Sturmzeit
man ihr mit, Frau Lavergne sei auf unbestimmte Zeit verreist.
Felicia warf ihren Kopf auf dem Kissen hin und her, ihr Gesicht glänzte schweißfeucht, sie bog den Hals zurück und atmete schnell und schneller. Ihre rechte Hand umklammerte Maksims Oberarm und spürte die Nässe seiner Haut zwischen den Fingern. Den anderen Arm hatte sie von sich gestreckt, die Hand krallte sich in das Bettuch, riß es aus der Matratze und zerknüllte es. Ihre Beine schlossen sich um die von Maksim, sie keuchte lauter, preßte sich an ihn und stieß ihn wieder von sich weg. Beinahe wütend, kämpfend, genossen sie orgiastische Höhen, zitternd und fiebernd lösten sie sich voneinander, erschöpft nicht nur von diesem Gefecht, sondern auch von ihrem immerwährenden Zweikampf, mit dem sie einander bewiesen, daß sie gleich stark und unabhängig waren.
Sie lagen minutenlang unbeweglich, dann öffneten sie die Augen und sahen erstes Morgenlicht durch die Vorhänge einfallen. Durch einen Spalt konnten sie den Himmel erkennen; er war tiefblau, aber der Wind jagte Wolke um Wolke darüber hinweg. Von einer Minute zur nächsten, das wußten sie, konnte es regnen, und ebenso schnell würde dann die Sonne wieder durchbrechen. Sie stellten sich den Wind in ihren Haaren vor, den Sand zu ihren Füßen, den salzigen Meeresgeschmack auf ihren Lippen und hatten Lust, an den Strand zu gehen. Es war Felicias Idee gewesen, nach Sylt zu fahren. Ihr steigender Verbrauch an Marihuana begann ihr Sorgen zu machen; sie glaubte, in der Einsamkeit, in der Natur, irgendwo zwischen hohen Wellen und weißen Dünen den Absprung vom Rauschgift finden zu können.
»Zurück zur Natur«, spottete Maksim, aber Felicia trat ihm heftig entgegen. »Wir gehen kaputt, Maksim. Merkst du das nicht?«
»O doch, wir verrotten. Aber immer noch besser, als in irgendeinem verdammten Ferienort Geselligkeit zu pflegen!«
»Wir fahren ja nicht nach Travemünde.«
»Dahin«, sagte Maksim, »würdest du mich auch nie bekommen.« Er ließ sich schließlich breitschlagen, nicht ohne sich täglich selbst zu verspotten, und beim Anblick des Kampener Friesenhauses, das Felicia gemietet hatte, zog er die Augenbrauen hoch. Doch trotz allem und trotz gelegentlicher Streitereien tat Sylt ihnen gut. Das Unruhige, Gehetzte wich aus ihren Wesen. Der Herbst war klar, trocken und sonnig, die Luft kalt und frisch.
Sie liefen am Meer entlang, gleich an der Brandung, hielten ihre Gesichter in den Wind und schrien auf, wenn ihnen die Wellen über die Füße schwappten. Sie gingen von Kämpen bis hinauf nach List und zurück, sie spürten ihre Füße kaum mehr, aber sie fühlten sich so leicht, daß sie bis ans Ende der Welt hätten laufen können. Kurz vor List konnten sie die Sonne als glühend rote Kugel ins Meer sinken sehen, während über ihnen der Himmel dunkel wurde und sich die Abendkälte über Strand und Dünen senkte. Auf dem Rückweg war es schon Nacht, über den Dünen leuchtete der Mond, und das Meer rauschte lauter. Sie gingen eng aneinander geschmiegt und schweigend, versunken in einen Frieden, den es nie vorher zwischen ihnen gegeben hatte. Vielleicht, dachte Felicia, weil es so ist, als seien außer uns keine anderen Menschen auf der Welt. Sie empfand Traurigkeit, weil ihr klar war, daß ein Rückzug aus dem Leben wie dieser immer zeitlich begrenzt und sein Ende zu jeder Minute absehbar sein würde.
Manchmal standen sie morgens früh auf und gingen spazieren über neblige Deiche am Wattenmeer, begleitet nur von ein paar Möwen. In irgendeiner verlassenen Kneipe tranken sie einen Kräuterschnaps, wechselten ein paar Worte mit den Männern, die am Tresen lehnten, und zogen weiter, unberührt von der Wirklichkeit, für seltene, verzauberte Stunden zwei Menschen ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Abends saßen sie meist in kleinen Restaurants, tranken Wein und aßen Fisch und sahen in die Kaminflammen.
»Was glaubst du«, fragte Felicia, »wenn wir beide alt sind, weißhaarig, gebeugt, werden wir wieder hier sitzen und die Tür vor der Welt zumachen?«
Maksims Augen ruhten in ihren; sie waren jung und amüsiert.
»Wahrscheinlich. Wir sagen einander weder, daß wir uns lieben noch, daß wir uns brauchen, aber wir ziehen einander in den schwierigen Phasen unseres Lebens an, und da es vielleicht das Schwerste von allem ist, das Leben zu Ende zu leben, verbringen wir womöglich noch unser Alter zusammen.«
»Bis dahin...«
»Bis dahin begehren wir einander auf infame, seelenlose
Weitere Kostenlose Bücher