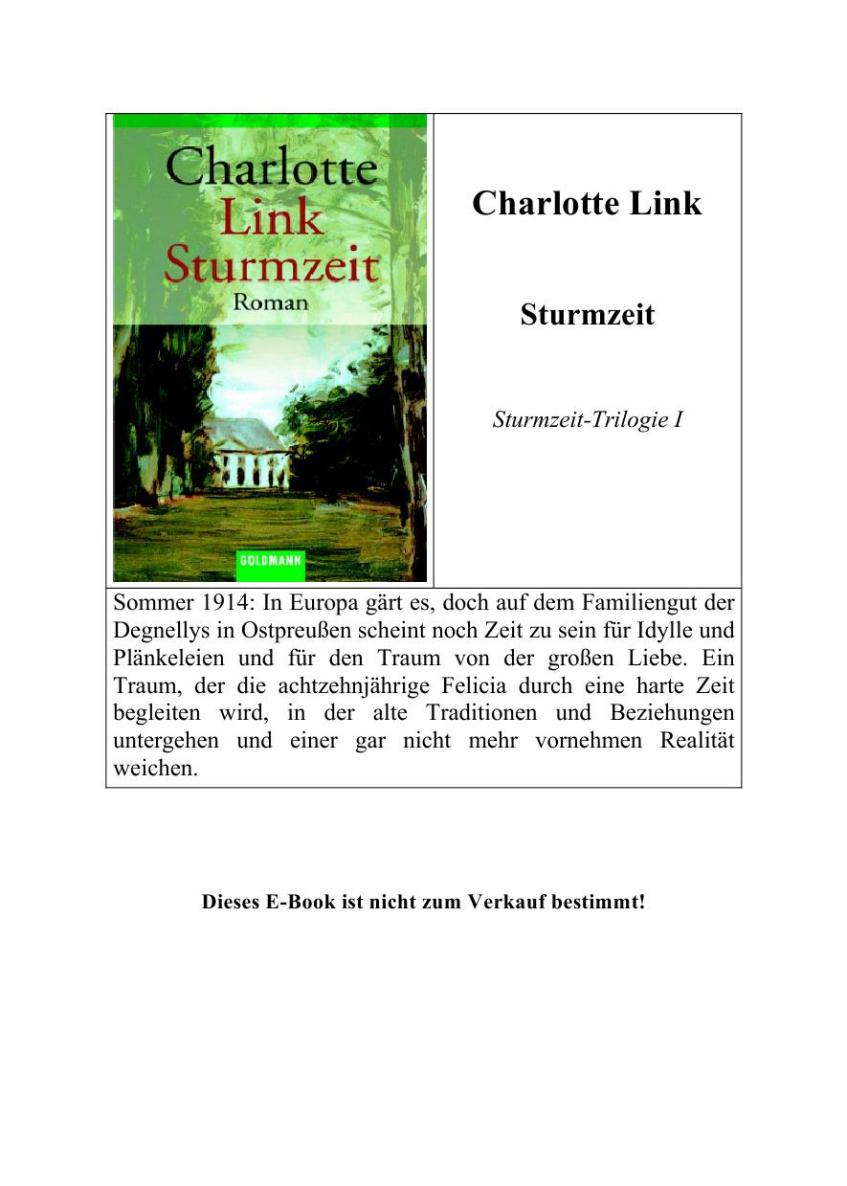![Sturmzeit]()
Sturmzeit
Weise«, sagte Maksim, und unter dem mißbilligenden Blicken einiger anderer Gäste lehnte er sich über den Tisch und küßte Felicias Mund.
Sara hing an dem Haus in der Prinzregentenstraße, und sie konnte Martins Begeisterung nicht recht teilen, als er ihr eines Abends erzählte, er habe endlich Arbeit gefunden und sie könnten sich jetzt eine eigene Wohnung leisten.
»Ein Verlag hat mich eingestellt! Endlich, Sara, ist es nicht wundervoll? Wir brauchen nicht mehr von Felicia zu leben!«
»Wir haben von meinem Gehalt gelebt«, erinnerte Sara,
»Felicia hat uns hier nur mietfrei wohnen lassen, weil sie nicht wollte, daß das Haus leersteht.«
»Egal. Wir sind jetzt unabhängig. Freust du dich nicht?«
»Du wolltest doch schriftstellerisch arbeiten. Was wird nun aus deinem Roman?«
»Das habe ich mir schon überlegt. Ich werde ihn an den Wochenenden und nachts schreiben. Hoffentlich stört es dich nicht zu sehr, wenn dann ständig die Schreibmaschine klappert?«
»Das nicht. Aber ich fürchte, du übernimmst dich.«
»Bestimmt nicht«, sagte Martin kühn, »äh... ich habe übrigens schon eine Wohnung für uns!«
Die Wohnung lag in der Hohenzollernstraße, hatte zwei Zimmer, Küche, Bad und einen kleinen Balkon, der zum Hinterhof hinausging und über Abfalltonnen und spielenden Kindern schwebte. Das Haus war in gutem Zustand, aber etwas dunkel und eng. Sara hatte, während sie über die finsteren Stiegen nach oben turnten, wieder einmal eine ihrer hellsichtigen Minuten und sagte: »Martin, ich kann es nicht erklären, aber es ist in mir ein Gefühl, als sei dieses Haus unsere Falle. Es gibt keinen zweiten Ausgang, nicht? Nur die eine Haustür, durch die wir hereingekommen sind?«
»Sara, die meisten Häuser haben nur eine Tür!«
»Nein. Normalerweise gibt es eine zweite zum Hof.«
»Nun, hier mußt du eben vorne hinausgehen und dann durch die Einfahrt in den Hof. Was ist dabei?«
»Nichts«, sagte Sara. Sie schämte sich ihrer Furcht. »Also, was ist, gefällt dir die Wohnung«, drängte Martin. Sara begriff, daß sein Herz daran hing.
»Sie gefällt mir. Wir sollten sie nehmen.« Sie trat schnell ans Fenster, um ein paar Sonnenstrahlen zu erhaschen, die stei ldurch die Scheiben fielen und ein paar goldene Flecken auf die zerschlissenen Vorhänge malten.
»Stirb und werde«, sagte Maksim nachdenklich. Er spielte mit einem langen Grashalm, ließ ein paar Sandkörner durch seine Finger rieseln, sah hinunter in die Heide, die violett flimmerte und süßlich nach schwarzen Beeren roch. Es war ein klarer, kühler Tag, aber an windgeschützten Stellen in den Dünen wärmte die Sonne noch. Felicia kauerte im Sand. Sie trug lange Hosen, einen dicken Wollpullover und hatte die Beine eng an den Körper gezogen. Weder hatte sie sich die Haare gebürstet noch das Gesicht geschminkt, und ihre grauen Augen sahen ohne die gewohnte schwarze Kajalumrandung seltsam kindlich und verletzbar aus.
»Stirb und werde«, wiederholte sie und versuchte aus den Tiefen ihres Gedächtnisses hervorzukramen, was sie in der Schule darüber gelernt hatte, »du willst sagen...«
»Ich will sagen, wir werden nicht als die von hier fortgehen, als die wir hergekommen sind. Wir wären kaputtgegangen in Berlin. Ich meine nicht das Marihuana. Es war einfach so, daß wir alles verloren hatten, was je wichtig gewesen ist für uns. Wir lebten, ohne zu wissen, wofür und weshalb, und was das Gefährlichste war: Wir genossen es, unseren Untergang grandios zu feiern.«
»Es war der beste Untergang, den je zwei Menschen hatten.«
Maksim lachte. »Er war so phantastisch, daß man am liebsten mit dem Untergehen nicht mehr aufhören wollte.«
»Aber wir werden aufhören?«
Er sah sie nachdenklich an. »Es wäre vielleicht das beste.«
Felicia lehnte sich zurück. Die Sonne schien ihr warm ins Gesicht, und wieder strömte eine Welle des herbstlich-würzigen Geruchs von der Heide in die Dünen hinauf.
»Ich glaube«, sagte sie leise, »ich werde nie aufhören, dem Geld nachzujagen.«
»Was weißt du, was kommt«, meinte Maksim unbestimmt. Er ließ noch immer den Sand durch seine Finger rieseln. Felicia betrachtete seine Hände und dachte: Wie merkwürdig ist es, daß ich diesen Mann ein Vierteljahrhundert liebe und nun nicht traurig bin über seine Worte.
»Zum erstenmal seit der Revolution fühle ich mich wieder stark«, sagte Maksim, »verstehst du, die Müdigkeit ist weg, die Trostlosigkeit, die Leere. Es kehrt etwas zurück, wovon ich
Weitere Kostenlose Bücher