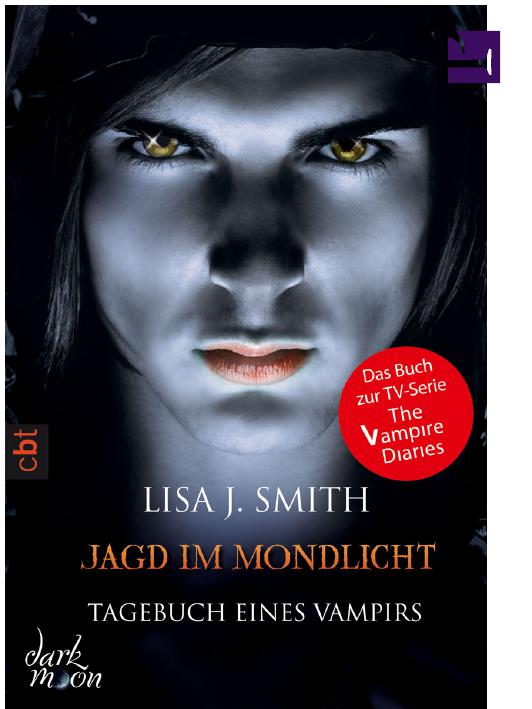![Tagebuch eines Vampirs 9 - Jagd im Mondlicht]()
Tagebuch eines Vampirs 9 - Jagd im Mondlicht
gewesen. Aber
trotzdem, es sah Samantha gar nicht ähnlich, nicht aufzutauchen, wenn
sie es versprochen hatte. Meredith schaltete ihr Handy ein, um nachzuse-
hen, ob sie eine SMS bekommen hatte, dann rief sie Samantha an. Keine
Reaktion. Das Handy war ausgeschaltet.
Meredith hinterließ eine kurze Nachricht auf der Mailbox, dann legte
sie auf und setzte ihre Dehnübungen fort. Dabei versuchte sie, das Unbe-
hagen zu ignorieren, das leise in ihr bebte. Sie ließ die Schultern kreisen
und streckte die Arme hinter ihrem Rücken.
Vielleicht hatte Samantha ihre Verabredung einfach vergessen. Viel-
leicht hatte sie verschlafen. Samantha war eine Jägerin; ihr drohte keine
Gefahr, von wem – oder was – auch immer.
Seufzend beendete Meredith ihr Aufwärmtraining. Sie würde sich sow-
ieso nicht mehr konzentrieren können, bis sie sich vergewissert hatte,
dass es Samantha gut ging. Was wahrscheinlich der Fall war. Zweifellos
ging es ihr gut. Sie griff nach ihrem Rucksack und ging zur Tür. Sie kon-
nte die Strecke joggen.
Die Sonne schien, die Luft war frisch und Meredith’ Füße setzten in re-
gelmäßigem Rhythmus auf, während sie im Slalom zwischen den Studen-
ten hindurchlief, die über den Campus schlenderten. Als sie Samanthas
Wohnheim erreichte, überlegte sie, ob Sam vielleicht mehr Lust hätte,
heute einen schönen, langen Lauf mit ihr zu unternehmen statt zu
kämpfen.
Sie klopfte an Samanthas Tür. »Aufwachen, Schlafmütze!« Die Tür war
nicht verriegelt und öffnete sich ein wenig.
»Samantha?«, fragte Meredith und drückte die Tür weiter auf.
Der Geruch traf sie mit solcher Wucht, dass Meredith rückwärts
taumelte und sich eine Hand auf Mund und Nase presste. Wie Rost und
Salz und Fäulnis.
192/308
Trotz dieses Geruchs konnte Meredith zuerst nicht verstehen, was da
überall an den Wänden war. Farbe?, fragte sie sich. Ihr Gehirn arbeitete
träge. Warum sollte Samantha ihre Wände anstreichen? So rot. Sie trat
langsam durch die Tür, obwohl zugleich ein Schrei in ihr aufstieg. Nein,
nein, lauf weg!
Blut. Blutblutblutblut! Meredith’ Trägheit war mit einem Schlag wie
weggeblasen: Ihr Herz hämmerte, ihr Kopf drehte sich, ihr Atem ging hart
und schnell. Der Tod war in diesem Raum.
Aber sie musste es sehen. Sie musste Samantha sehen. Obwohl jeder
Nerv in ihrem Körper sie drängte zu rennen, zu kämpfen, schob Meredith
sich weiter in das Zimmer hinein.
Samantha lag auf dem Rücken und das Bett unter ihr war rot und
durchnässt von Blut. Sie sah aus, als sei sie in Stücke gerissen worden.
Ihre offenen Augen starrten leer und ohne einen Wimpernschlag zur
Decke.
Sie war tot.
Kapitel Sechsundzwanzig
»Sind Sie sich sicher, dass wir nicht ihre Eltern anrufen sollen, Miss?«
Die Stimme des Sicherheitsmannes vom Campus war von schroffer Fre-
undlichkeit und er blickte besorgt drein.
Für eine Sekunde malte Meredith sich die Art von Eltern aus, die der
Wachmann sich vermutlich vorstellte. Eltern, die sofort kommen würden,
um ihre Tochter zu retten, um sie nach Hause zu bringen, bis die schreck-
lichen Bilder vom Tod ihrer Freundin verblasst wären. Ihre Eltern jedoch
würden ihr lediglich sagen, dass sie ihren Job machen solle. Sie würden
ihr sagen, dass jede andere Reaktion gleichzusetzen wäre mit Scheitern.
Wenn sie sich erlaubte, schwach zu sein, würden noch mehr Leute
sterben.
Und das galt erst recht, da Samantha eine Jägerin gewesen war, aus
einer Familie von Jägern, wie Meredith. Meredith wusste genau, was ihr
Vater sagen würde, wenn sie ihn anrief. »Lass dir das eine Lehre sein. Du
bist niemals sicher.«
»Ich komme schon zurecht«, erklärte sie dem Mann. »Meine Mitbe-
wohnerinnen sind oben.«
Er ließ sie gehen und sah ihr mit bekümmerter Miene nach, wie sie die
Treppe hinaufstieg. »Keine Sorge, Miss«, rief er ihr hinterher. »Die Pol-
izei wird diesen Kerl schnappen.«
194/308
Meredith verkniff sich die Bemerkung, dass er offenbar eine Menge
Vertrauen in eine Polizeitruppe setzte, die noch immer keine Hinweise
auf den Aufenthaltsort der verschwundenen Studenten hatte, und der es
noch immer nicht gelungen war, Christophers Ermordung aufzuklären.
Aber er versuchte nur, sie zu trösten. Sie nickte ihm zu und winkte
schwach.
Sie war auch nicht erfolgreicher gewesen als die Polizei, nicht einmal
mit Samanthas Hilfe. Sie hatte sich nicht genug Mühe gegeben, hatte sich
zu sehr von der neuen Umgebung, den neuen Leuten
Weitere Kostenlose Bücher