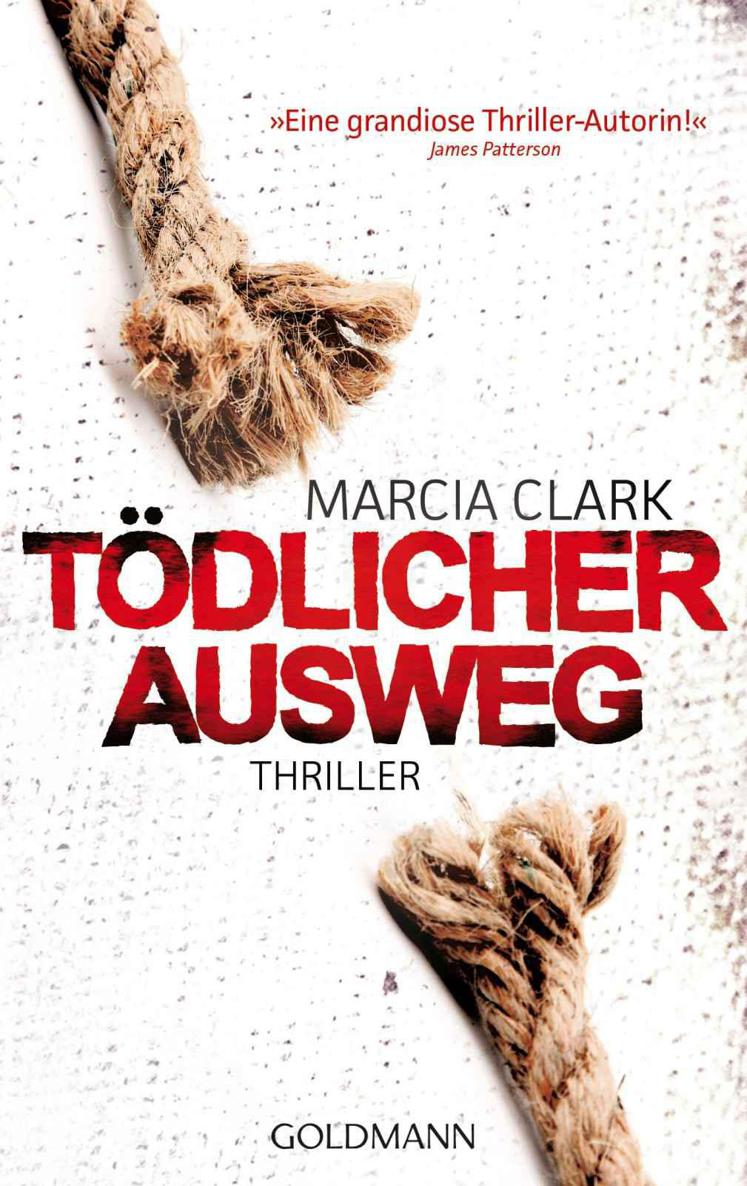![Tödlicher Ausweg: Thriller (German Edition)]()
Tödlicher Ausweg: Thriller (German Edition)
bedeutete mir, mich endlich zu setzen, und goss uns Kaffee ein. Sie nahm die Servierhaube von ihrem Teller und roch an ihrem buttrig süßen French Toast. »Zimmerservice«, sagte sie hochzufrieden. »Wie schön, hier zu sein.« Sie trank einen Schluck Kaffee und fügte hinzu: »Und natürlich auch schön, für dich da zu sein.«
Die Prioritätenfrage wollte ich lieber nicht klären. Stattdessen genoss ich den ersten Bissen von meinem opulenten Schinken-Käse-Sandwich und versuchte, mir noch einmal den Angriff zu vergegenwärtigen.
»Hat er eigentlich meine Handtasche mitgenommen?«, fragte ich. Meine Waffe hatten die Sanitäter in meiner Manteltasche gefunden. Extrem hilfreich war sie ja nicht gewesen.
»Gute und schlechte Nachricht«, sagte Bailey und machte sich an ihren Kartoffelpuffern zu schaffen.
»Die schlechte«, sagte ich.
»Er hat dein Portemonnaie mitgenommen.«
»Und die gute?«
»Deine Handtasche hat er dagelassen. Deine Kreditkarten haben wir schon alle sperren lassen, und wenn ich mich recht entsinne, hattest du nicht viel Bargeld dabei.«
Das stimmte. Ich hatte der Kellnerin im Marie Callender’s ein Trinkgeld geben wollen, hatte aber kaum etwas dabei. Allerdings würde ich mir einen neuen Führerschein machen lassen müssen. Und schlimmer noch, ein neues Führerscheinfoto.
»Ich hatte noch nie Probleme hier, und ich habe auch noch nie von einem derartigen Vorfall im Biltmore gehört«, sagte ich.
»Ich weiß.« Bailey nickte. »Und selbst wenn Sätze wie: ›Hier kann so etwas gar nicht passieren‹, niemals einen Sinn ergeben, gibt mir die Sache doch zu denken.«
Mir auch, und zwar seit dem Moment, als ich im Krankenhaus die Augen aufgeschlagen hatte. Hinter der Feuerleiter folgte nur noch meine Suite.
»Er hat auf mich gewartet«, sagte ich.
59
E in lastendes Schweigen senkte sich herab, als wir darüber nachdachten, wer der Angreifer gewesen sein könnte.
»Wir hatten soeben mit zwei Skinheads von gegnerischen Fraktionen gesprochen«, sagte ich. »Und Lonnie haben wir ziemlich zugesetzt, um an seinen Chef heranzukommen.«
Bailey nickte. »Vielleicht wollte uns der PEN1 warnen.«
»Das war zumindest die letzte Station in unseren Ermittlungen.«
»Womöglich will dich die eine Seite benutzen, um die andere reinzureiten«, sagte Bailey.
Auf eine verquere Weise ergab das einen Sinn, wenn man bedachte, wer diese Leute waren.
»Dann ist wohl jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen, um mit ihrem Grand Wizard zu reden, wie hieß er noch mal … Dominic«, sagte ich. »Wenn es einer seiner Leute war, dann muss er den Befehl gegeben haben.« Eine Staatsanwältin anzugreifen war ein starkes Stück, das tat man nicht ohne Zustimmung von höchster Stelle.
»Grand Wizard heißt der Boss vom Ku-Klux-Klan«, korrigierte mich Bailey.
»Danke«, sagte ich trocken. »Ich weiß es zu schätzen, dass du mich vor der Peinlichkeit bewahrst, den Oberdeppen der Skinheads mit dem falschen Titel anzureden.«
Bailey legte die Serviette auf den Tisch, schnallte sich das Pistolenholster um und kontrollierte das Magazin ihrer Glock. Ich folgte ihrem Beispiel, ging zum Kleiderschrank, wo ich meine Feuerwaffen aufbewahrte, und entschied mich für die dickste im Sortiment – die .44 H&K. Der Angriff auf meine Person ließ mich eine völlig neue Perspektive auf die Selbstverteidigung einnehmen. Hätte ich zufällig eine da, würde ich mich für die Panzerfaust entscheiden.
»Ich würde den Oberdeppen nicht zu hart angehen«, sagte Bailey und nahm ihren Mantel. »Zumindest nicht, solange wir nicht vom Gelände runter sind.«
»Gelände?«
»Dominic Rostoni lebt auf einem Firmengelände in Calabasas«, sagte Bailey. »Er ist Skinhead und Unternehmer.«
»Na toll.« Ich steckte das Magazin in meine .44, vergewisserte mich, dass sie gesichert war, und legte sie in meine Handtasche.
»Die bleibt sowieso im Wagen«, sagte Bailey. »Mit den Dingern lassen die uns nie im Leben rein.«
Wir wechselten einen Blick. Wenn unser Gespräch mit Dominic nicht günstig verlief, würde Sicherheit ein wichtiges Thema werden.
Schließlich perfektionierte ich mit Hilfe von Make-up und Abdeckstift meine Erscheinung und präsentierte mich dann Bailey. »Na, was meinst du?«
Sie betrachtete mein Gesicht. »Besser wirst du es wohl kaum hinbekommen.«
Mit diesen ermutigenden Worten verließen wir meine Suite. Anfangs kam ich nur frustrierend langsam voran. Ich wollte aber nicht wie eine Neunzigjährige zu diesem Treffen humpeln
Weitere Kostenlose Bücher