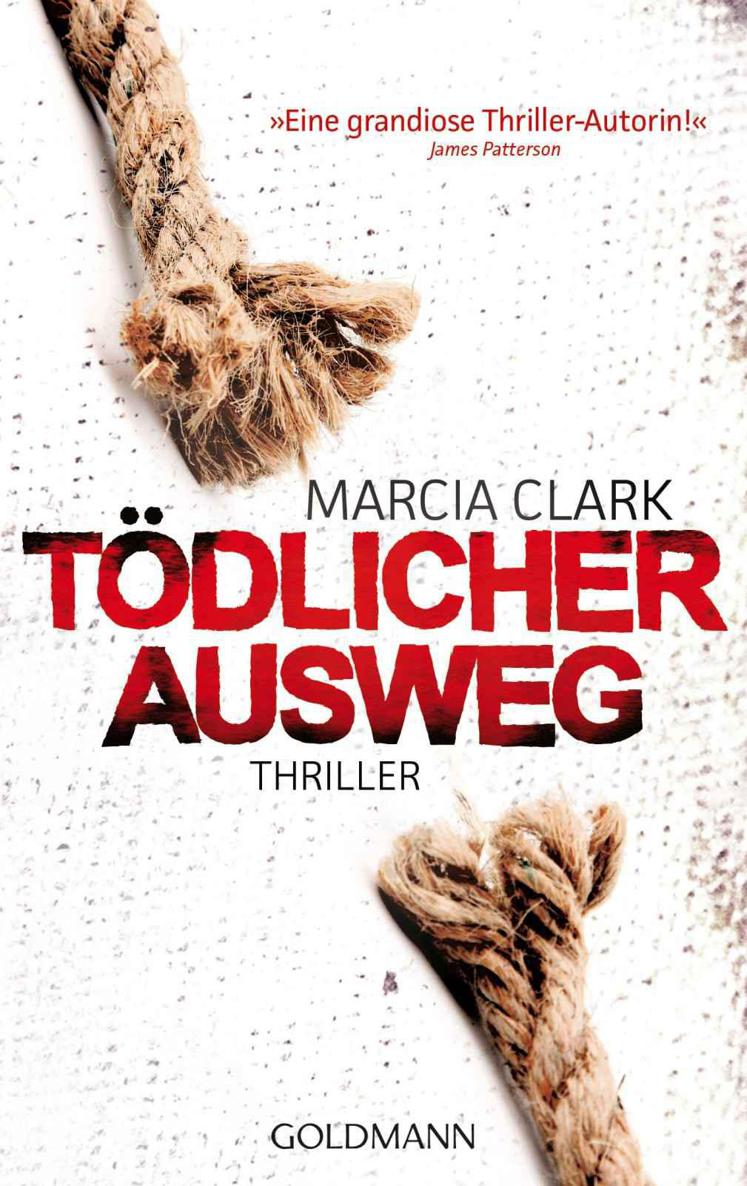![Tödlicher Ausweg: Thriller (German Edition)]()
Tödlicher Ausweg: Thriller (German Edition)
Pünktchen in der Ferne war und das Knirschen der Reifen sich verloren hatte.
Ich rannte und schrie noch, als der Wagen längst verschwunden war, bis mich plötzlich ein stechender Schmerz in der Seite zu Boden stürzen ließ. Da lag ich dann und keuchte und schnappte nach Luft, während mir die Tränen übers Gesicht strömten. Irgendwann stand ich wieder auf, schluchzend und immer noch atemlos. Das konnte gar nicht wahr sein – und ich weigerte mich, darüber nachzudenken, was dieses »das« überhaupt sein sollte. Stattdessen redete ich mit mir selbst, eine alte kindische Angewohnheit, und sagte mir, dass Romy noch in ihrem Lieblingsversteck war. Ich sagte mir, dass sie dort sein musste . In der Überzeugung, dass es gar nicht anders sein konnte, humpelte ich auf Romys Baum zu. Auf dem Weg dorthin hielt ich mir die Seite und redete laut vor mich hin, ein langer Bewusstseinsstrom: »Romy, bitte sei dort, bitte, bitte. Ich werde dich auch nie wieder zwingen, Verstecken zu spielen, das verspreche ich dir, Romy, bitte, bitte. Bitte sei dort! Bitte sei dort, Romy!« Mein Atem ging stoßweise, meine Stimme war rau und heiser.
Der Baum war leer.
An das, was dann passierte, kann ich mich nicht erinnern, aber man hat mir gesagt, dass ich auf meinem Irrweg durch den Wald einem Arbeiter der Hühnerfarm über den Weg lief, schluchzend, schmutzig, die Kleidung zerrissen. Ich konnte oder wollte nicht sprechen, und als der Mann versuchte, mich aus dem Wald zu führen, trat und biss ich ihn, bis er es aufgab und den Sheriff holte. Damals hatte ich keine Erklärung dafür, aber vermutlich dachte ich in meinem Kinderhirn, dass es, solange ich im Wald blieb, eine Chance gab, Romy irgendwo wiederzutreffen und alles ungeschehen zu machen.
Tatsächlich habe ich meine Schwester nie wiedergesehen.
Irgendwann zog ihr Verschwinden – ich weigerte mich beharrlich, die Möglichkeit ihres Todes in Betracht zu ziehen – das meiner Eltern nach sich. Als mein Vater starb, erlosch auch das winzige Flämmchen, das noch in den Augen meiner Mutter geflackert hatte. Sie rutschte in eine klinische Depression ab, die sie wochenlang zur Bewegungslosigkeit verdammte. Als ihre Krankenversicherung auslief, schaffte sie es irgendwie, wieder zur Arbeit zu gehen und Essen auf den Tisch zu bringen, aber ich wusste, dass sie das nur für mich machte. Bis dahin hatte ich es nicht für möglich gehalten, mich noch schuldiger zu fühlen, als ich es ohnehin schon tat.
Was mich betraf, verlor ich nicht nur meine Familie, sondern auch meine Freunde, für die ich nur noch ein Objekt von Mitleid und Faszination war. Die Geschichte von Romys Verschwinden beherrschte die Lokalnachrichten. Es gab keinen Ort, wo man nicht mit dem Finger auf mich gezeigt oder mich sogar direkt nach jenem Tag gefragt hätte.
Sosehr ich mein Leben hasste, kam ich nicht auf die Idee, irgendetwas zu unternehmen. Auf der Highschool änderte sich das plötzlich. Eines Tages und ohne jeden ersichtlichen Grund fragte ich mich, warum wir nicht einfach weggingen. In einer anderen Stadt wäre meine Mutter weit weg von dem Ort, der nichts als qualvolle Erinnerungen bereithielt, und ich könnte ein anderer Mensch werden. Nie wieder wäre ich die Sensation der Stadt. Und auch diese verdammten Wälder würde ich nie wiedersehen müssen.
Es kostete ein wenig Zeit und Mühe, meine Mutter zu überzeugen, aber ich war unerbittlich. Ich entschied mich für Los Angeles. Groß, anonym und nicht so weit entfernt, um Angst einzuflößen. Gemeinsam lernten wir, ein neues Leben zu leben. Meine Mutter fand ihr Lächeln wieder, und ich fand eine neue Identität als ganz normaler Mensch. Es waren schöne Jahre, in denen wir eine Nähe spürten, von der wir nichts gewusst hatten. Vor drei Jahren hatte man dann ein Melanom bei meiner Mutter diagnostiziert, und sechs Monate später war sie gestorben. Sie hatte mir mal anvertraut, dass sie nach dem Verlust von Romy und dann meines Vaters nie wieder irgendein Glück in ihrem Leben erwartet hatte. Die Freude, die wir in diesen Jahren gefunden hatten, war ein unerwartetes Geschenk gewesen.
Der Tod meiner Mutter war ein schrecklicher Schlag. Plötzlich war ich wirklich allein. Tonis und Baileys Freundschaft hatte mir durch diese Zeit geholfen, aber nicht einmal sie wussten etwas von Romy.
Als ich hierhergezogen war, hatte ich mich bewusst dazu entschieden, niemandem von ihr zu erzählen. Carla, meine Psychiaterin, war der Meinung, es sei kein gutes Zeichen, dass
Weitere Kostenlose Bücher