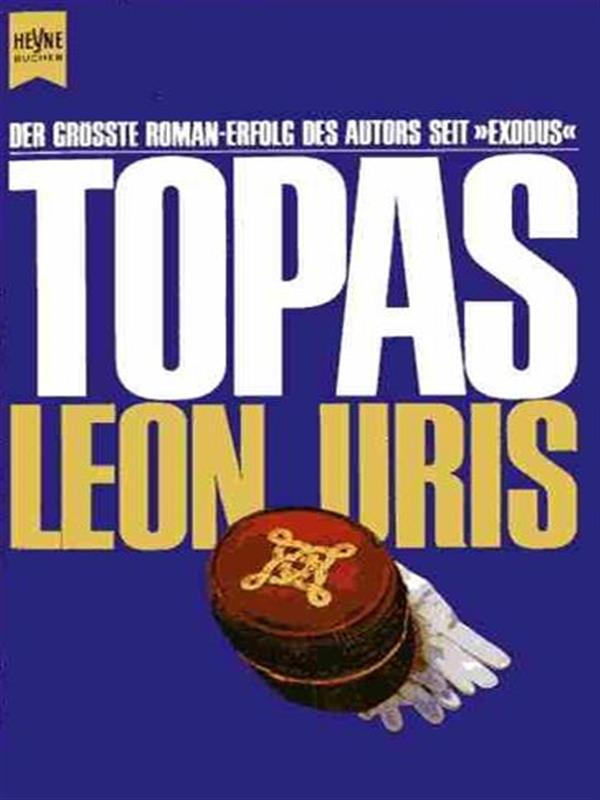![Topas]()
Topas
und engste Freund, den Andre und sie
hatten.
»Ich bin ein
Schuft«, meinte er.
»Allerdings,
mein Lieber. Das ist nichts Neues.«
»Nein, nein.
Schau, ich wußte, daß du am Wochenende entweder in
Montrichard sein oder eine Verabredung haben würdest. Deshalb
zögerte ich, dich anzurufen.«
»Ich hatte mir
vorgenommen, ein paar Tage in Ruhe Platten zu hören und mich
in Bücher zu vertiefen, die ich schon lange lesen
wollte.«
»Du mußt
mir einen großen Gefallen tun. Erinnerst du dich an Guy de
Crecy?«
»Ja, wir sind
uns gelegentlich begegnet. Botschafter in Ägypten,
ja?«
»Ganz
recht… das heißt, er war es bis vergangene Woche. Wir
haben ihn nach Paris zurückgerufen. Der arme Teufel ist
gestern erst angekommen, und in ein paar Tagen schon jage ich ihn
mit einem Sonderauftrag nach Fernost. Ich geb ihm bei mir ein
kleines Abendessen, ganz unter uns, weißt du, nur fünf
oder sechs Paare.«
»Ist er denn
nicht mehr verheiratet?«
»Witwer. Hat
seine Frau vor einem Jahr verloren.«
»Oh, das
wußte ich nicht.«
»Sei ein Schatz,
Nicole, und komm.«
»Nur dir
zuliebe, Jacques.«
»Ich liebe dich,
ich liebe dich. De Crecy holt dich gegen acht ab.«
Mit einem starken
Gefühl der Erleichterung - die Einsamkeit war wieder einmal
für einen Abend verscheucht - hängte Nicole ein.
Seltsamerweise verursachte ihr dann die Aussicht, Guy de Crecy
wiederzusehen, ein angenehmes Herzklopfen.
53
Nicole war lange vor
Guy de Crecys Ankunft fertig und ließ ihn nur ein paar klug
berechnete Augenblicke warten. Sie erschien in blendender
Aufmachung, und es freute sie, daß er sich über ihren
Anblick freute.
Guy de Crecy war ein
Mann von fünfzig Jahren, alles andere als hübsch, aber
mit jener Art von kräftig durchgebildetem Gesicht, das einen
Mann oft begehrenswerter macht. Er gab sich mit der höflichen
Sicherheit und Ungezwungenheit, die durch jahrelanges
Florettfechten auf diplomatischem Parkett erworben
werden.
Während sie zu
Granvilles Wohnung fuhren, floß die Unterhaltung leicht und
angenehm dahin. De Crecy hatte erwachsene Kinder, einen Sohn und
eine Tochter. Nach dem Tod seiner Frau sei das Leben für ihn
recht einsam geworden. Er sei froh, aus Ägypten wegzukommen,
und erbost darüber, daß man ihn schon in wenigen Tagen
in den Fernen Osten hetze. Nun ja, später werde es für
ihn ein paar Monate in Paris geben.
Nicole erzählte
nichts über ihre Trennung von Andre, sondern erwähnte
nur, sie sei nach Paris zurückgekehrt, um über den Stand
der Dinge in Frankreich auf dem laufenden zu bleiben und weil ihre
Tochter an der Sorbonne zu studieren beginne. Sie liebe Washington,
log sie.
Mehr als einmal hatte
Andre, wenn er in bissiger Stimmung war, erklärt, sie
hätte von vornherein einen Mann wie Guy de Crecy heiraten
sollen. Der werde nie an Überarbeitung sterben, werde stets
auf der richtigen Seite des politischen Zaunes stehen und sich nie
erlauben, einen heiklen oder unpopulären Entschluß zu
fällen; er gedeihe im Gesellschaftsklüngel und
offiziellen Gepränge und bete die äußeren Zeichen
des Erfolgs an.
Jacques Granville
bewohnte ein Appartement im Hotel Meurice. Er war vom kleinen
Offizier im Zweiten Weltkrieg zum Stellvertretenden Chef des
Präsidialamts aufgestiegen und bekleidete damit eine der
einflußreichsten Stellungen Frankreichs.
Die Eleganz seiner
Pariser Wohnung im Meurice bekundete Granvilles Rang und
Reichtum. Paulette, seine vierte und jüngste Frau,
begrüßte die Gäste im Empfangsraum, und der
charmante Jacques, ein silbergrauer, mit allen Wassern gewaschener
Weltmann, belebte die Willkommensgrüße mit gallischen
Temperamentsausbrüchen.
Bald war der Salon von
Diplomatenklatsch erfüllt, gewürzt mit dem dafür
typischen Witz und ausgezeichnetem Champagner. Alle Anwesenden, mit
Ausnahme des NATO-Wirtschaftsreferenten Henri Jarre, waren
Persönlichkeiten von hohem Rang, die zum engsten Kreis um La
Croix gehörten.
Die Unterhaltung
geriet natürlich in antiamerikanisches Fahrwasser.
Am lautesten und
giftigsten äußerte sich Henri Jarre, ein Mann mit einem
dichten schwarzen Haarschopf, buschigen Augenbrauen, einem mageren
blassen Gesicht und einem nach Intellektuellenart zynisch
verzogenen Mund. »Ich sage, zum Teufel mit den Amerikanern.
Gar nicht wegen ihrer diplomatischen Schnitzer oder vielmehr ihres
völligen Mangels an Diplomatie, sondern weil sie den Finger am
atomaren Abzug haben. Ich möchte jedenfalls nicht erleben,
daß diese Parvenüs einen Krieg
Weitere Kostenlose Bücher