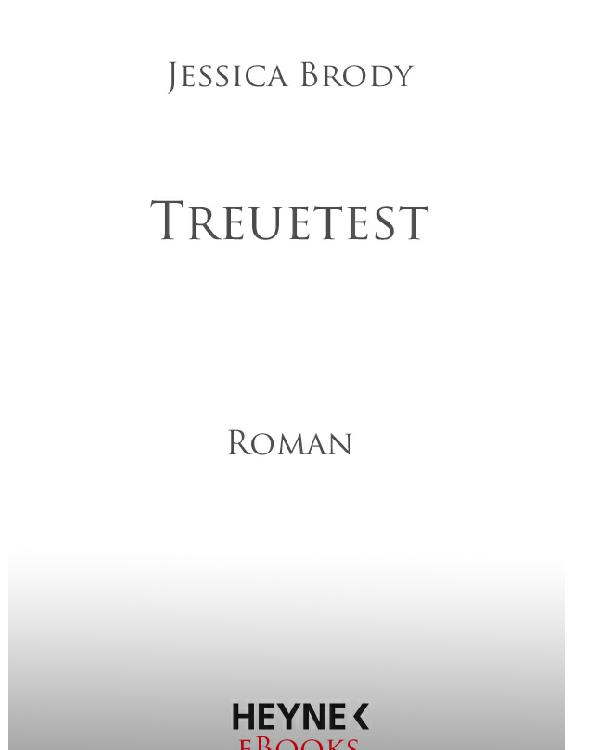![Treuetest - Brody, J: Treuetest - The Fidelity Files]()
Treuetest - Brody, J: Treuetest - The Fidelity Files
ändern muss.
»Warte«, hörte ich Raymond sagen. Ich registrierte aus dem Augenwinkel, wie er seine Hose aufhob, die im Eifer des Gefechts mitten auf dem Fußboden liegen geblieben war. Er zückte eine schwarze Lederbrieftasche und öffnete sie. »Was
zahlt sie dir? Einen Tausender? Fünfzehnhundert? Ich gebe dir das Doppelte.«
Ich drehte mich um und sah, wie er seiner Brieftasche ungerührt einen dicken Stapel Hundertdollarnoten entnahm und sie abzuzählen begann. »Hier geht es nicht um Geld«, erwiderte ich kategorisch und setzte meinen Weg zur Tür fort.
»Es geht immer um Geld«, widersprach er verächtlich. »Wie viel willst du?«
Ich blieb stehen, überlegte einen Augenblick und wandte mich ein letztes Mal zu ihm um.
Raymond grinste triumphierend.
»Tut mir aufrichtig leid«, sagte ich. »Aber meine Loyalität kann man nicht kaufen.«
Jetzt grinste er herablassend. »Glaub mir, Schätzchen, ich kann mir alles kaufen.«
Genau in diesem Moment fiel mein Blick auf einen kleinen, glänzenden Gegenstand auf dem Teppich. Sein Ehering. Er musste ihm aus der Brusttasche gefallen sein, als wir uns vorhin so hastig unserer Kleider entledigt hatten. Ich bückte mich, hob ihn auf und legte ihn mit der Behutsamkeit eines Chirurgen bei einer Operation am offenen Herzen auf die Kommode. »Irrtum«, entgegnete ich.
Wie es danach weitergeht, entzieht sich grundsätzlich meiner Kenntnis. Meine Arbeit ist getan. Was auch immer danach geschieht, fällt nicht mehr in meinen Zuständigkeitsbereich. Meine Aufgabe ist es, festzustellen, ob der Kandidat die Absicht hat, Ehebruch zu begehen oder nicht.
Das hatte ich getan.
Jetzt war es Zeit für mich, zu gehen.
Also ging ich.
2
Eine vielversprechende Heilslehre
Meine Mission war vom ersten Tag an sonnenklar.
Die Wahrheit aufzudecken. Meinen Auftraggeberinnen Gewissheit zu verschaffen, damit sie die Möglichkeit haben, einen Schlussstrich zu ziehen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen.
Nicht alle halten meine Arbeit für ehrenwert. Deshalb weiß kaum jemand darüber Bescheid. Besser gesagt, niemand .
Nicht einmal meine engsten Freundinnen und Freunde.
Oder meine Familie.
Für meine Mitmenschen bin ich Jennifer Hunter, eine hart arbeitende, erfolgreiche Investment Bankerin, die für eine Bank namens Stanley Marshall tätig ist. Das war ich auch.
Der Jobwechsel war einfach zu kaschieren: neue Telefonnummer dank einer lange erhofften Beförderung, im Zuge derer ich ein neues Firmenhandy erhielt; ein anspruchsvoller Chef und zahlreiche kapitalkräftige Großkunden, deren Betreuung jede Menge Überstunden und Geschäftsreisen erfordert. Sämtliche Details mussten streng vertraulich bleiben, ich behauptete einfach, ich hätte ein entsprechendes Abkommen unterzeichnen müssen. Die perfekte Tarnung.
Ich schätze, das macht mich zu einer Art Doppelagentin.
Ich führe ja auch ein Doppelleben: eines, über das nur ich Bescheid weiß, und eines, über das meine Mitmenschen »Bescheid wissen«. Ich würde meine Familie und meine Freunde ja einweihen, aber sie könnten es nicht verstehen. Meine Freundin Sophie würde mich beschuldigen, Familien zu zerstören, und auch meine Freundin Zoë würde mich wohl nie mehr mit denselben Augen sehen.
Sie könnten meine Beweggründe nicht nachvollziehen.
Sie würden mir unterstellen, dass ich bewusst mit verheirateten Männern flirte, Beziehungen ruiniere, Familien auseinanderreiße. Einen Keil zwischen Ehepaare treibe.
So würden jedenfalls die meisten Menschen meine Tätigkeit beschreiben.
Meiner Ansicht nach ist das eine äußerst oberflächliche Betrachtungsweise. Wenn man genauer hinsieht, steckt viel, viel mehr dahinter. Aber um meine Beweggründe nachvollziehen zu können, müssten sie wissen, was ich weiß. Sie müssten gesehen haben, was ich gesehen habe.
Deshalb behalte ich mein Geheimnis für mich.
Außerdem ist Anonymität eine wichtige Voraussetzung für meine Tätigkeit – und das Geheimnis meines Erfolges.
Nun fragt sich vielleicht so mancher, wie ich das überhaupt Tag für Tag durchziehen kann. Wie ich es schaffe, objektiv zu bleiben. Mich zu distanzieren.
Ob ich mir nicht eigentlich wünschen müsste, dass alle den Test bestehen.
Tja, es geht hier aber nicht darum, was ich mir wünsche.
Würde man auf der Straße Passanten anhalten und fragen, ob sie sich eine Welt ohne Verbrechen wünschen, dann würden höchstwahrscheinlich alle antworten: »Natürlich, wünscht sich das nicht jeder?« Das ändert
Weitere Kostenlose Bücher