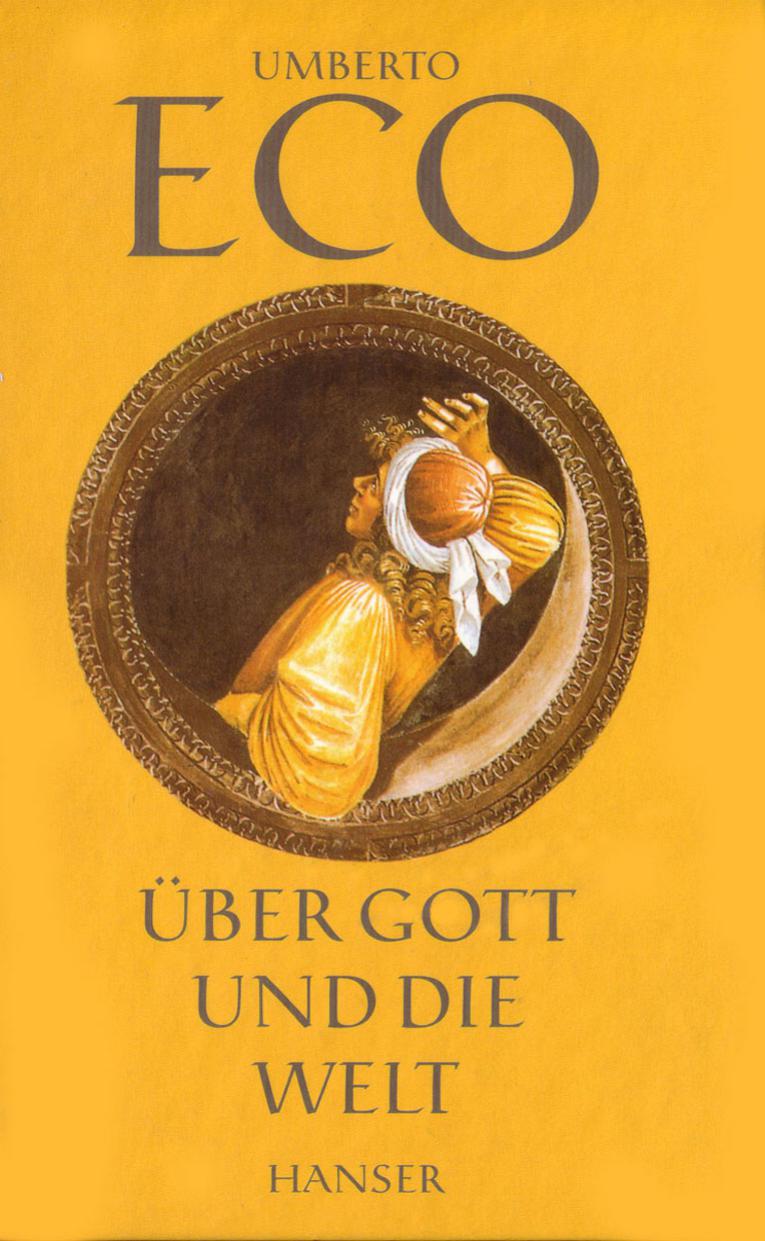![Über Gott und die Welt]()
Über Gott und die Welt
in der Presse fand (Le Monde widmete ihr eine ganze Seite), ist nun unter dem schlichten und überaus stolzen Titel Leçon bei den Editions du Seuil erschienen50, ein Büchlein von kaum mehr als vierzig Seiten, das aus drei Teilen besteht. Der erste behandelt die Sprache, der zweite die Funktion der Literatur im Verhältnis zur Macht der Sprache und der dritte die Semiologie, insbesondere die Literatursemiologie.
Sagen wir gleich, daß wir uns hier nicht mit dem dritten Teil beschäftigen werden (der in seiner Kürze eine lange Methodendiskussion erfordern würde) und nur summarisch mit dem zweiten. Denn der erste wirft, wie uns scheint, ein Problem von weit größerer Tragweite auf, das über die Literatur und die Techniken ihrer Erforschung hinausgeht, um die Frage der Macht zu berühren. Eine Frage, die sich auch durch die anderen hier summarisch behandelten Bücher zieht.
Barthes’ Antrittsvorlesung, die rhetorisch glänzend aufgebaut ist, beginnt mit einer Eloge auf die Würde, die er zu bekleiden sich anschickt. Wie man vielleicht weiß, beschränken sich die Professoren des Collège de France auf das Sprechen, die reine Lehre: Sie nehmen keine Prüfungen ab, sie haben nicht die Macht, Kandidaten zu promovieren oder durchfallen zu lassen, man besucht ihre Vorlesungen aus Liebe zu dem, was sie sagen.
Daher die Freude, die Barthes gleich zu Anfang äußert (auch hier wieder schlicht und überaus stolz): Ich betrete einen Ort
»außerhalb der Macht«. Natürlich ist das Heuchelei, denn nichts verleiht in Frankreich mehr kulturelle Macht als ein Lehrstuhl am Collège de France, einem Ort, an dem Wissen produziert wird. Aber das ist ein anderes Thema. In dieser Vorlesung (in der es, wie wir sehen werden, um das Spiel mit der Sprache geht) treibt Roland Barthes, wenn auch mit offenen Karten, ein Spiel: Er stellt eine Defi nition der Macht zur Debatte und setzt eine andere voraus.
Barthes ist zu feinsinnig, um Foucault zu ignorieren, im Gegenteil, er dankt ihm ausdrücklich als seinem Freund und Fürsprecher im Collège; und so weiß er und sagt es auch, daß die Macht nicht »eine« ist, sondern daß sie gerade dort, wo sie sich einschleicht, ohne daß man es gleich bemerkt, »im Plural« auftritt wie die Dämonen, deren Name Legion ist, ja daß die Macht »in den feinsten Mechanismen des gesellschaftlichen Verkehrs gegenwärtig ist: nicht nur im Staat, in den Klassen, den Gruppen, sondern ebenso in den Moden, gängigen Meinungen, Schauspielen, Spiel- und Sportveranstaltungen, Informationen, familiären und privaten Beziehungen, selbst noch in den Befreiungsschlägen, durch die versucht wird, sie in Frage zu stellen«. Darum erklärt er:
»Ich nenne Diskurs der Macht jenen Diskurs, der Schuld erzeugt und infolgedessen Schuldgefühle bei dem, der ihn aufnimmt.«
Man mache eine Revolution, um die Macht zu zerstören, und sogleich wird sie unter den neuen Verhältnissen Wiederaufl eben.
Denn »die Macht ist der Parasit eines transsozialen Organismus, der mit der ganzen Geschichte des Menschen zusammenhängt, nicht nur mit seiner politischen, historischen Geschichte«. Und:
»Das Objekt, in das die Macht sich einschreibt, seit es den Menschen gibt, ist das Sprechen – oder genauer, sein bindender Ausdruck: die Sprache.«51
Nicht im Sprechvermögen als solchem gründet die Macht, sondern im Sprechen, das zu einer Ordnung gerinnt, zu einem System von Regeln, zur Sprache als Code. Die Sprache, sagt Barthes (in einem Diskurs, der auf weite Strecken, ich weiß nicht, wie bewußt, die Positionen Benjamin Lee Whorfs wiederholt), zwingt mich, wenn ich eine Handlung aussprechen will, als Subjekt aufzutreten, und so ist dann das, was ich tue, nur Folge und Fortsetzung dessen, was ich bin; die Sprache zwingt mich, zwischen maskulin und feminin zu wählen, sie verbietet mir die Konzeption einer neutralen oder komplexen Kategorie; ich bin gezwungen, den anderen entweder mit »Sie« oder mit »du« anzu-sprechen, ich habe nicht das Recht, mein affektives oder soziales Verhältnis in der Schwebe zu lassen. Natürlich spricht Barthes vom Französischen, das Englische würde ihm mindestens die beiden letztgenannten Freiheiten wiedergeben, allerdings (wür-de er mit Recht sagen) ihm dafür andere nehmen. Konklusion:
»So impliziert die Sprache durch ihre bloße Struktur bereits eine unvermeidliche Entfremdung.« Sprechen heißt sich unterwerfen, die Sprache ist eine verallgemeinerte Reaktion. Mehr noch, die Sprache »ist
Weitere Kostenlose Bücher