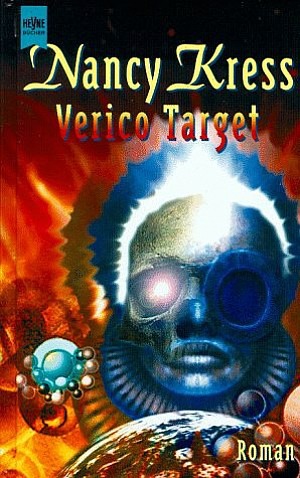![Verico Target]()
Verico Target
des Tages, im Kampf ums Überleben und um
ihre Identität. Das Orchester spielt einen Tusch, die Medien
sind avisiert, und sie erhält das Verwundetenabzeichen.
Bloß – womit würde sie die nächsten vier Tage
ausfüllen? Diesen Tag? Diese Stunde?
Sie würde putzen.
Unwillkürlich mußte Judy laut auflachen. Das war
für ihre Mutter stets die Lösung, und Mutter hatte es von
Großmutter: Wenn du nicht weiterweißt, dann putze. Als
Feministin mit einem Magistertitel war sie nicht fortschrittlicher
als ihre eingewanderte Großmutter, Kathleen O’Malley, die
auf den Gehsteig gespuckt hatte, um den bösen Blick abzuwehren,
und die während eines Gewitters kein Metallbesteck benutzte, um
zu verhindern, daß der Blitz in ihre Küche einschlug.
Und wen, zum Geier, kümmerte es? Wenn es ihre Gedanken von
ihrer eigenen trübseligen Person ablenkte, dann würde sie
eben das Haus putzen. Und nach dem Putzen würde sie sich das
Haar färben. Rot. Um jemand anders zu sein. Warum auch nicht?
Sie war doch auch von Vorgängen, die sich ihrer Kontrolle
entzogen, zu jemand anderem gemacht worden. Rotes Haar – das
hatte sie unter Kontrolle.
Hausputz hatte sie unter Kontrolle.
Sie holte einen Eimer aus der Waschküche und stellte Spic
& Span, Windex und Murphys Schmierseife bereit. Zum erstenmal
fiel ihr auf, wie verdreckt das Haus tatsächlich war. Niemand
hatte hier saubergemacht seit August, seit…
Sie beschloß, mit dem Wohnzimmer anzufangen. Das
Schlafzimmer und besonders Bens Arbeitszimmer würden ihr mehr
zusetzen. Das Umstellen der Möbel, um darunter staubzusaugen,
und die Jagd nach Münzen, Knöpfen und Krümeln unter
den Sofakissen (du lieber Himmel, was für unappetitliches Zeug
sich doch in den Falten und Ritzen der Polsterung ansammelte!) trugen
tatsächlich dazu bei, daß sie sich hinterher besser
fühlte. Sie machte das Wohnzimmer fertig und wechselte ins
Eßzimmer. Sie öffnete die untersten Türen des
Porzellanschrankes, um auch dort gründlich abzustauben, und da
fand sie das Protokollbuch.
Die Polizei hatte das Haus nach dem Mord durchsucht – nicht
nur Bens Arbeitszimmer, sondern mit ihrer Zustimmung das ganze Haus.
Sie hatte ihnen Bens Terminkalender gegeben, sein Notizbuch, sein
Adreßbuch, ja sogar die Zeitschriften, die er unter dem Bett
aufbewahrte und die er vor dem Einschlafen las. Sie hatte nie
vermutet, daß es noch mehr geben könnte.
Nein. Das stimmte nicht. Sie hatte es vermutet. Und sie
wußte, was das hier war, noch ehe sie es aufschlug.
Es war kein persönliches Tagebuch. Keines seiner Mädchen
würde sich hier wiederfinden, um Judy das Herz zu
zerreißen. Dafür war Ben zu vorsichtig gewesen.
Vorsichtig, aber – sie hatte es immer gewußt –
eitel.
Der erste Eintrag war zwei Jahre alt.
Die Notizen eines Wissenschaftlers. Klingt
prätentiös, ich weiß, aber ich spüre einen
inneren Drang, meine emotionalen Reaktionen auf die Arbeit im Labor
festzuhalten – Reaktionen, die im Grunde genommen weder in die
Protokollbücher des Projekts noch in mein persönliches
Tagebuch gehören. Wissenschaft bedeutet so unendlich viel mehr
als nur Berechnungen und Experimente: Wissenschaft ist die
systematische Erfassung der Wahrheit und der Art und Weise, wie wir,
die wir uns mit der Wissenschaft beschäftigen, diese Wahrheit
bewerten und beurteilen.
Judy wand sich. Das war Ben von seiner schlechtesten Seite:
schwerfällig, umständlich. Sich für die Nachwelt in
Positur werfend. Dieses Notizbuch war dazu bestimmt, eines fernen
Tages seinem Biographen ausgehändigt zu werden –
selbstverständlich nur äußerst widerwillig, das war
Judy klar, aber letztendlich zweifellos doch. Deshalb hatte Ben es ja
angelegt. Er dokumentierte seine eigenen kostbaren Gedanken und
erzeugte so selbst den Spiegel, in dem er sich einst reflektiert
sehen wollte.
Aber weshalb befand sich das Notizbuch im Porzellanschrank,
zwischen Tischtüchern, die nie verwendet wurden? Ganz leicht zu
erklären, eigentlich. Ben litt an Schlaflosigkeit. Wenn er nicht
schlafen konnte, ging er nach unten, wärmte sich eine Tasse
Milch und trank sie am Wohnzimmertisch, wo Judy die leere Tasse des
öfteren am Morgen vorfand. Diese Zeit mußte er dazu
benutzt haben, seine Notizen niederzuschreiben.
Heute war einer jener Tage, an denen man rückwärts zu
schreiten scheint. Nichts klappte. Caroline sagte zu mir:
»Denkst du, daß Dea Nukleia sich von uns abgewendet
hat?« Dea Nukleia, die Muse der Gentechnik.
Weitere Kostenlose Bücher