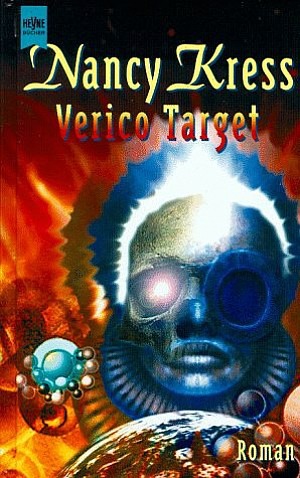![Verico Target]()
Verico Target
Sonntag vor
Thanksgiving, dem letzten Donnerstag im November, und sie hatte, wie
sie gerade bemerkte, absolut nichts zu tun. Nada. Null.
Nicht, daß sie allzuviel getan hätte, seit sie nach
Natick zurückgekehrt war. Sie hatte beinahe die ganze Zeit in
der öffentlichen Bibliothek mit ›Nachforschungen‹
verbracht. Ja. Richtig. Sie hatte sämtliche
Veröffentlichungen gelesen, in denen Verico erwähnt wurde.
Alle drei. ›NEUE BIOTECH-FIRMENGRÜNDUNG‹.
›EXPANDIERENDER MARKT FÜR JUNGE MOLEKULARBIOLOGEN‹.
›NICHT IMMER IST BIOTECHNIK DER WEG ZUM PROFIT‹. In jedem
der beiden letztgenannten Artikel war Verico nur der Erwähnung
in einem einzigen Satz für würdig befunden worden.
Judy hatte das Internet benutzt, um alles über Eric Stevens
herauszufinden und seine beiden Veröffentlichung zu
überfliegen, aber sowohl der Mann als auch sein Werk waren von
geradezu auffallender Bedeutungslosigkeit. Judy war noch
weitergegangen und hatte in den behördlichen Datenbänken
nach Stevens’ Leumund, seinen Vermögensverhältnissen
und seinen Familienbindungen gesucht. Nichts. Sie hatte in Yale
angerufen, wo Stevens studiert, und bei der Universität des
Staates New York in Stony Brook, wo er kurze Zeit unterrichtet hatte.
Bei beiden Anrufen hatte Judy sich als mögliche künftige
Arbeitgeberin ausgegeben, die Stevens’ Unterlagen und Zeugnisse
überprüfen wollte. Nichts. Stony Brook hatte Stevens’
frühere Unterrichtstätigkeit bestätigt, aber der
Inhaber des Lehrstuhls war erst seit vier Jahren an der
Universität und kannte Stevens nicht persönlich. Und auch
an dem Krankenhaus, an dem er seine Ausbildung abgeschlossen hatte,
erinnerte sich keiner an ihn.
Eric Stevens war offenbar ein unbeschriebenes Blatt, und Judy
wurde von Tag zu Tag frustrierter.
Doch noch gab sie nicht auf. Die öffentlich zugänglichen
Datenbänke enthielten ja nur Hintergrundinformationen. Verico
hatte vor Ben noch mit einer anderen Person gesprochen, und von
dorther würden die wirklichen Informationen kommen. Den Anfang
machte Barbara McBrides Party.
Aber bis dahin waren es noch sechs Tage, was bedeutete, noch sechs
Tage hinzubiegen. Donnerstag früh würde sie nach Troy
fahren, um Thanksgiving zusammen mit ihren Eltern zu feiern. Freitag
abend würde sie dann wieder heimfahren. Samstag hatte sie vor,
lang zu schlafen und den Nachmittag mit der Herstellung der
Currynüsse zu verbringen; vielleicht würde sie
außerdem noch Käsestangen backen. Und dann mußte sie
sich natürlich für die Party zurechtmachen. Aber da blieben
immer noch der heutige Tag und dazu Montag, Dienstag und Mittwoch
übrig.
Vier Tage.
Plötzlich vergrub Judy das Gesicht in den Händen. O
Gott, wie sie das haßte! Sie hatte nie zu den Frauen
gehört, die auf jede nur vorstellbare Art die Zeit totschlugen,
damit die leeren Stunden zwischen zwei Parties oder zwei Reisen
rascher vergingen. Sie hatte solche Frauen stets verabscheut. Sie
– Judy Kozinski, sie! – hatte immer mehr als genug
zu tun gehabt. Interessante Dinge, wesentliche Dinge. Sie hatte
Recherchen für wissenschaftliche Artikel angestellt und
glückliche Stunden an ihrem Computer verbracht, wenn sie sie
schrieb; sie hatte freiwillige Sozialarbeit für die Obdachlosen
geleistet und verfügte über einen großen
Freundeskreis, sie liebte viktorianische Prosa und begleitete Ben zu
den wissenschaftlichen Kongressen…
Jedesmal, wenn sie sich vor den Computer setzte, fühlte sie
eine Leere im Gehirn – eine ganz eigenartige verschwommene
Leere, durch die schmerzhaft klare Pünktchen schwebten, und die
Pünktchen, das waren Erinnerungen an Ben. Jedesmal, wenn sie ein
Buch aufschlug, geschah das gleiche. Und jenes eine Mal, als sie den
Versuch gemacht hatte, sich wieder einmal beim Unterstand der
Obdachlosen einzufinden, hatte ihr Herz so zu rasen begonnen,
daß sie es kaum bis zum Wagen zurück schaffte.
Das war jener Teil eines Mordes, über den niemand sie
aufgeklärt hatte: Daß es nicht nur das Leben mit dem Toten
war, das verlorenging, sondern daß es alles am Leben
betraf, alles, woran man gewöhnt war, jede einzelne Reaktion im
Leben. Alles verändert, alles dahin. Man verlor nicht nur den
Ehemann, man verlor alles.
Nein. Das konnte nicht stimmen. Es würde auch nicht stimmen,
denn sie würde dagegen ankämpfen, sich dagegen wehren, so
heftig sie konnte, um wiederum Judy Kozinski zu sein. Sie selbst.
Klang das nicht tapfer? Na gut, dann war sie also tapfer. Judy
Kozinski, die Heldin
Weitere Kostenlose Bücher