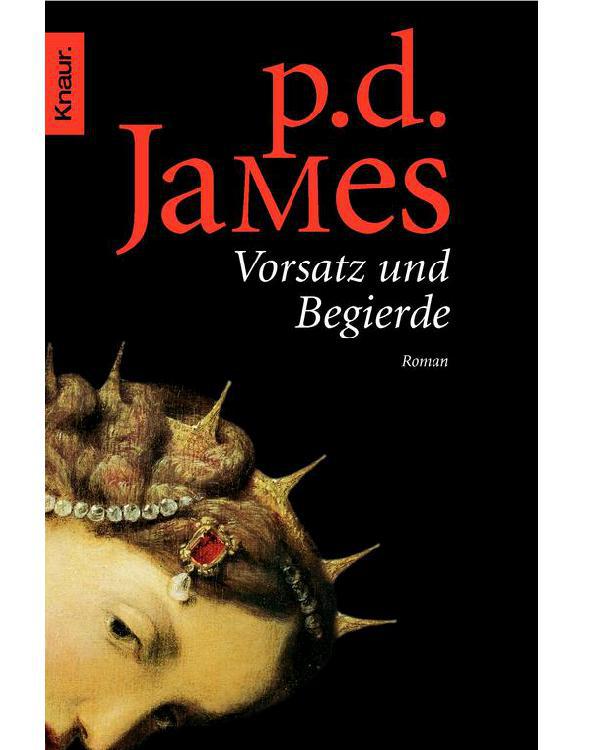![Vorsatz und Begierde (German Edition)]()
Vorsatz und Begierde (German Edition)
Hilary immer gut ausgekommen. Du kommst mit jedermann im Werk gut aus. Du bist die letzte, für die sich die Polizei interessieren würde. Du hast nicht mal ein Motiv.«
»Doch, ich habe eines. Ich habe sie noch nie gemocht. Und ihren Vater habe ich gehaßt. Er hat meine Mutter zugrunde gerichtet, sie dazu gebracht, ihre letzten Lebensjahre in Armut zu verleben. Und ich habe dadurch die Chance auf eine gute Ausbildung verloren. Ich bin Sekretärin, eigentlich Stenotypistin, und weiter kann ich es nicht bringen.«
»Ich habe immer angenommen, du könntest das werden, was immer du willst.«
»Nicht ohne eine Ausbildung. Gut, man kann ein Stipendium bekommen, aber ich mußte die Schule verlassen, um möglichst schnell Geld zu verdienen. Es geht nicht nur um mich; es geht auch darum, was Peter Robarts meiner Mutter angetan hat. Sie hat ihm vertraut. Sie hat jeden Penny, den sie besaß, jeden Penny, den Vater hinterlassen hat, in seine Plastikfirma gesteckt. Ich habe ihn gehaßt, und ich habe seinetwegen sie gehaßt. Wenn die Polizei das herausbringt, habe ich keinen Frieden mehr. Doch wenn ich ein Alibi vorweisen kann, ist das nicht möglich. Man wird uns, uns beide, in Ruhe lassen. Wir brauchen nur anzugeben, wir wären zusammengewesen. Das genügt.«
»Aber die Polizei kann doch nicht das, was Hilarys Vater deiner Mutter angetan hat, als Mordmotiv bewerten. Das wäre unverständlich. Außerdem liegt das schon so lange zurück.«
»Kein Mordmotiv ist vernünftig. Die Menschen töten aus den sonderbarsten Gründen. Außerdem verunsichert mich die Polizei. Ich weiß, es ist irrational. Aber so war’s schon immer. Deswegen fahre ich auch so vorsichtig. Ich würde eine Vernehmung nicht durchstehen. Ich habe Angst vor der Polizei.«
Sie spielte da auf etwas an, das einen wahren Kern hatte, so als könne diese nachprüfbar richtige Aussage allein schon ihren Wunsch rechtfertigen. Sie hielt beim Fahren in der Tat penibel das Tempo-Limit ein, selbst wenn die Straße leer war, legte stets den Sicherheitsgurt an, achtete auf den Zustand ihres Wagens. Er erinnerte sich an einen Vorfall vor drei Wochen: Beim Einkauf in Norwich hatte man ihr die Handtasche entrissen, was sie trotz seiner Einwände nicht der Polizei melden wollte. »Es hat doch keinen Sinn«, hatte sie gesagt. »Man wird sie mir nicht mehr wiederbringen. Wir vergeuden nur unsere Zeit auf dem Polizeirevier. Laß uns gehen! Sie enthielt ohnehin nicht viel.«
Er ertappte sich dabei, daß er überlegte, ob ihre Angaben der Wahrheit entsprachen, und empfand ein Gefühl der Scham, dem Mitleid beigemischt war.
»Na schön, ich verlange zuviel«, redete sie weiter. »Ich weiß, wie du über die Wahrheit denkst, über Ehrlichkeit, ich kenne dein Pfadfinder-Christentum. Ich verlange von dir, daß du deine Selbstachtung opferst. Das macht niemand gern. Wir brauchen unsere Selbstachtung. Du hältst dich für moralischer als andere Menschen. Aber bist du da nicht ein Heuchler? Du sagst, du liebst mich, willst aber nicht mir zuliebe lügen. Die Lüge ist doch unerheblich. Sie schädigt niemanden. Aber du bringst es nicht über dich, weil es gegen deine religiöse Einstellung verstößt. Deine ach so kostbare Religion hat dich aber nicht davon abgehalten, mit mir ins Bett zu gehen, oder? Ich habe gedacht, Christen seien viel zu keusch für gelegentliche Unzucht.«
Heuchler, Unzucht! Jedes Wort war wie ein Schlag, der ihn da traf, wo es weh tat. Er hatte mit ihr nie über seinen Glauben gesprochen, auch in jenen wunderbaren ersten Tagen nicht, die sie miteinander verbrachten. Sie hatte ihm von Anfang an zu verstehen gegeben, daß derlei ein Teil seines Lebens sei, für den sie weder Sympathie noch Verständnis habe. Wie konnte er ihr bloß klarmachen, daß er ihr ohne Schuldgefühle ins Schlafzimmer gefolgt war, weil sein Verlangen nach ihr stärker gewesen war als seine Gottesliebe, stärker als seine Scham, sein Glaube. Wie konnte etwas unrecht sein, hatte er sich eingeredet, das jede Faser seines Körpers ihm als natürlich, richtig, ja sogar heilig signalisierte?
»Lassen wir es«, sagte sie. »Ich verlange zuviel.«
Von ihrem verächtlichen Tonfall zutiefst getroffen, erwiderte er beklommen: »Das stimmt nicht. Ich halte mich nicht für besser, ich bin’s nicht. Und du kannst mir nicht zuviel abverlangen. Wenn’s für dich wichtig ist, mache ich es selbstverständlich.«
Sie musterte ihn, als wollte sie seine Ehrlichkeit, seine Willenskraft abschätzen. Als sie
Weitere Kostenlose Bücher