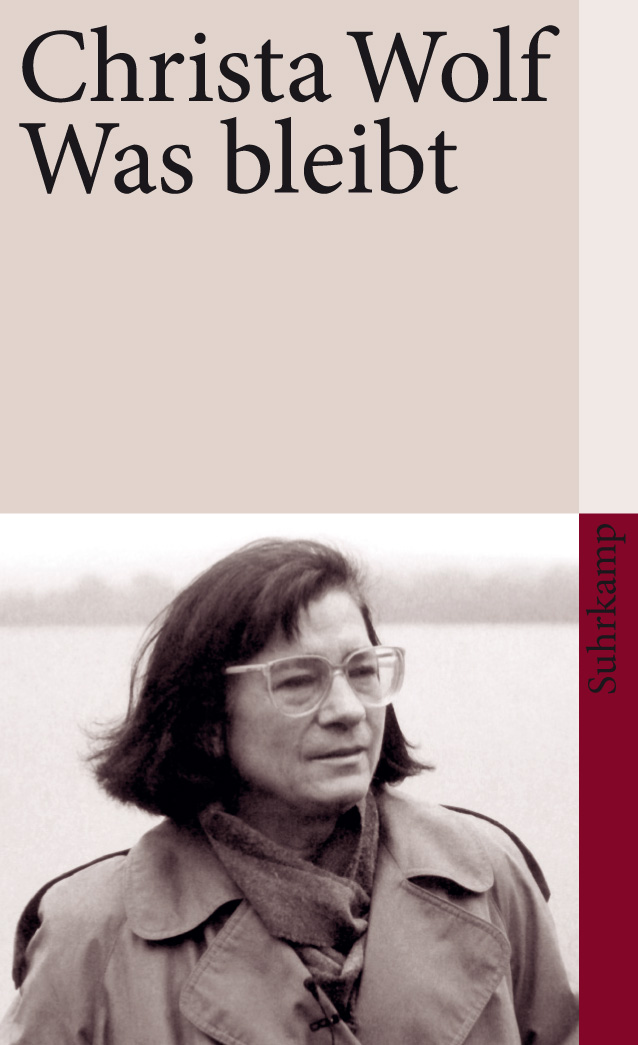![Was Bleibt]()
Was Bleibt
guten Tag, lieber Selbstzensor, lange nichts von Ihnen gehört. Also wer soll es denn sein, wenn nicht Jürgen M., nach deiner Meinung? – Ein unvoreingenommener Beamter, der dich gar nicht kennt. – Das wäre mir sogar lieber. – Lieber ist gut. – Immerhin. Einer, der kein persönliches Interesse an mir hat. Der mir nichts beweisen will. Der mich nicht auf meinem ureigenen Feld ausstechen will.
Wie Jürgen M.? Komm zu dir!
Aus Erfahrung wußte ich: Innerer Dialog ist dem inneren Dauermonolog vorzuziehen. Also gab ich meinem inneren Zensor zu bedenken, was den Jürgen M. sicherlich antreibe: Nämlich daß er danachgierte, mir zu beweisen, nicht nur ein Schreiber könne alles über eine Person herausfinden – er könne das, auf seine Weise, auch. Auch er könne sich, wie jeder x-beliebige Autor, zum Herrn und Meister seiner Objekte machen. Da aber seine Objekte aus Fleisch und Blut sind und nicht, wie die meinen, auf dem Papier stehen, ist er der eigentliche Meister, der wirkliche Herr.
Und du, sagte die unwillkommene Stimme, die sehr taktlos sein kann, willst also mit ihm in den Wettbewerb treten? Willst den Fehdehandschuh aufnehmen? Ihm zeigen, wer der Meister ist? Da hat er doch schon gewonnen, dein sauberer Jürgen.
Aber was soll ich denn sonst machen, fragte ich mich, während ich den Briefkasten im Hausflur aufschloß, Post und Zeitungen herausnahm, was soll ich denn machen. Die Treppe hoch, auf den Flurspiegel zu, der noch nicht zerschlagen ist. Daß ich blaß war, hatte nichts zu sagen, Luftmangel eben, da wünschte die Stimme mir viel Vergnügen im Mittelalter, und ich nannte sie unverschämt. Übrigens, habe der brausetrinkende junge Mann da unten im Auto nicht etwas Rührendes gehabt? – Ich solle einen unwürdigen Vorgang nicht verniedlichen. – So gehe es noch um Würde? – Noch? Aber das fange doch gerade erst an.
Wer aber sagte uns, was Würde sei?
Ich fing an, meine Post zu lesen, nach den üblichen Präliminarien; nachdem ich mich vergewisserthatte, daß kein unliebsamer Absender dabei war, keiner, der mich ängstigte. Nachdem ich die Umschläge so gegen den Lichteinfall gehalten hatte, bis jener sich spiegelnde Kleberand zutage trat, der offenbar durch das zweite Zukleben entstand. Viel seltener waren die Klebränder der Briefumschläge stärker gewellt als üblich, und nur vereinzelt fand ich den Briefbogen innen an das Kuvert angeklebt. Derartige Pannen sollten vermeidbar sein. Irgendwo – sicherlich nicht mal im verborgenen – mußte es ein riesiges Haus geben (oder gab es etwas kleinere Häuser in allen Bezirken?), in dem täglich waggonweise Post angeliefert wurde, die dann an einem langen Fließband von fleißigen Frauenhänden sortiert und nach uns undurchschaubaren Gesichtspunkten anderen Stockwerken zugeleitet wurde, wo wiederum Frauen über Dampf – oder gab es inzwischen effektivere Methoden? – vorsichtig, vorsichtig die Briefe öffneten und sie dem Allerheiligsten zuführten, in dem versierte Kollegen die Ablichtungsapparaturen bedienen mochten, die wir in unseren Bibliotheken und Verlagshäusern so schmerzlich vermißten. Ein Heer von Mitarbeitern, dem niemals eine Würdigung in der Presse zuteil wurde; dem kein Tag im Jahr gewidmet war, wie den Bergleuten, den Lehrern oder den Mitarbeitern des Gesundheitswesens; eine gewiß immer weiter anwachsende Schar, die sich damit abfinden mußte, im Dunkeln zu wirken. Das Wort »Dunkelziffer«hakte sich in mir fest, ich schrieb es auf einen Zettel. Die Tätigkeit großer Bevölkerungsteile verschwindet in einer Dunkelziffer. Ich sah Menschenmengen in einen tiefen Schatten eintauchen. Ihr Los kam mir nicht beneidenswert vor.
Die Zeitungen legte ich beiseite, nachdem ich die Schlagzeilen überflogen hatte. Drei Briefe hatte ich noch nicht geöffnet. Ich wußte, von wem sie kamen, obwohl auf dem einen weder ein Absender stand noch eine Briefmarke klebte: Der Absender, ein sehr junger Dichter, pflegte seine Post selbst in meinen Hausbriefkasten zu stecken. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Nach seinen Gedichten – diese neuen waren in einem Lager für vormilitärische Ausbildung entstanden – stellte ich mir einen zartgliedrigen stillen Jungen mit sanften blauen Augen vor, der litt, ohne sich wehren zu können, und überlebte, indem er Gedichte schrieb; ich las die Gedichte dieses Jungen widerstrebend, weil ich ihm nicht helfen konnte, ich schrieb ihm ausweichend, und ich war manchmal wütend auf ihn, mehr noch auf mich. Er
Weitere Kostenlose Bücher