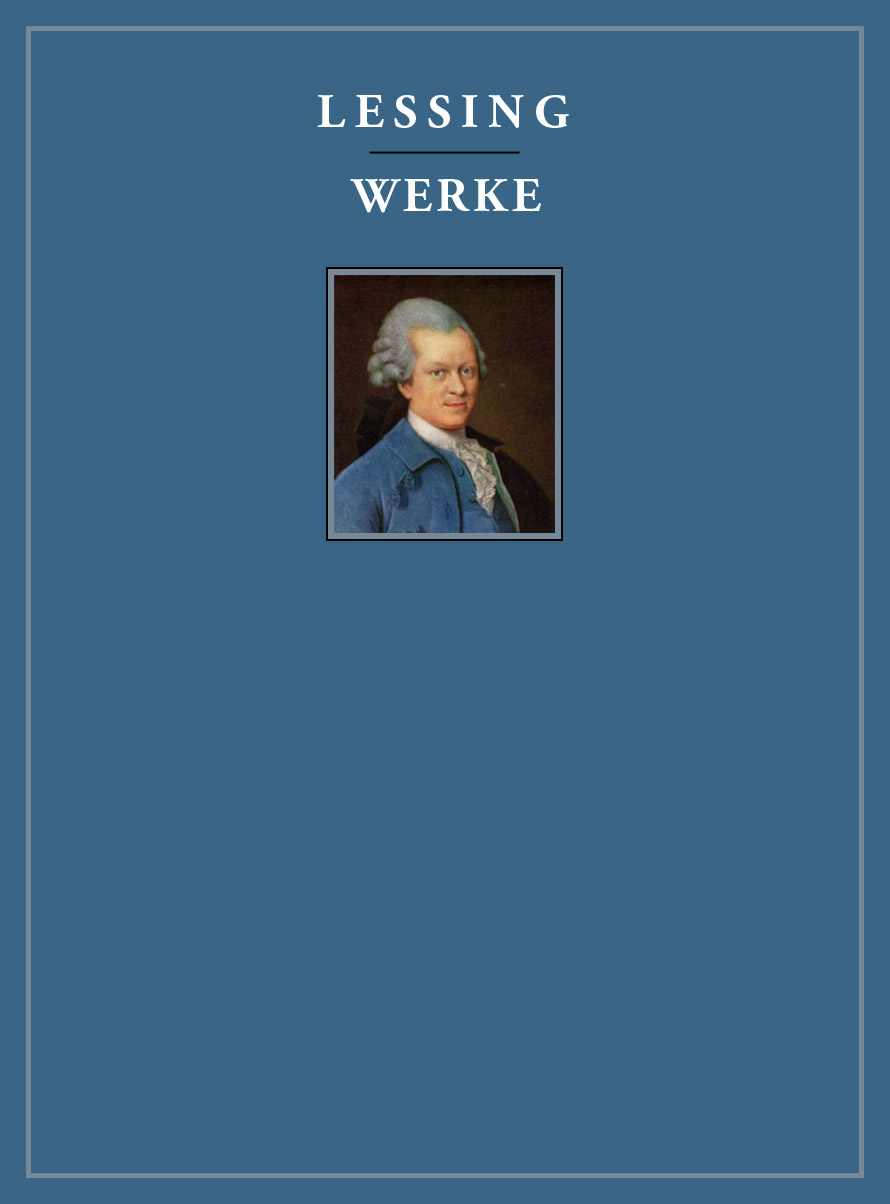![Werke]()
Werke
daß sich begreifen läßt, warum sie kamen, oder warum sie wieder verschwinden? Wie viel wird in beiden dem Zufall überlassen? Wie oft sehen wir die größesten Wirkungen durch die armseligsten Ursachen hervorgebracht? Wie oft das Ernsthafte und Wichtige mit einer leichtsinnigen Art, und das Nichtsbedeutende mit lächerlicher Gravität behandelt? Und wenn in beiden endlich alles so kläglich verworren und durch einander geschlungen ist, daß man an der Möglichkeit der Entwicklung zu verzweifeln anfängt: wie glücklich sehen wir durch irgend einen unter Blitz und Donner aus papiernen Wolken herabspringenden Gott, oder durch einen frischen Degenhieb, den Knoten auf einmal zwar nicht aufgelöset, aber doch aufgeschnitten, welches in so fern auf eines hinauslauft, daß auf die eine oder die andere Art das Stück ein Ende hat, und die Zuschauer klatschen oder zischen können, wie sie wollen oder – dürfen. Übrigens weiß man, was für eine wichtige Person in den komischen Tragödien, wovon wir reden, der edle Hanswurst vorstellt, der sich, vermutlich zum ewigen Denkmal des Geschmacks unserer Voreltern, auf dem Theater der Hauptstadt des deutschen Reiches erhalten zu wollen scheinet. Wollte Gott, daß er seine Person allein auf dem Theater vorstellte! Aber wie viel große Aufzüge auf dem Schauplatze der Welt hat man nicht in allen Zeiten mit Hanswurst, – oder, welches noch ein wenig ärger ist, durch Hanswurst, – aufführen gesehen? Wie oft haben die größesten Männer, dazu geboren, die schützenden Genii eines Throns, die Wohltäter ganzer Völker und Zeitalter zu sein, alle ihre Weisheit und Tapferkeit durch einen kleinen schnakischen Streich von Hanswurst, oder solchen Leuten vereitelt sehen müssen, welche, ohne eben sein Wams und seine gelben Hosen zu tragen, doch gewiß seinen ganzen Charakter an sich trugen? Wie oft entsteht in beiden Arten der Tragi-Komödien die Verwicklung selbst lediglich daher, daß Hanswurst durch irgend ein dummes und schelmisches Stückchen von seiner Arbeit den gescheiten Leuten, eh sie sichs versehen können, ihr Spiel verderbt?« –
Wenn in dieser Vergleichung des großen und kleinen, des ursprünglichen und nachgebildeten, heroischen Possenspiels – (die ich mit Vergnügen aus einem Werke abgeschrieben, welches unstreitig unter die vortrefflichsten unsers Jahrhunderts gehört, aber für das deutsche Publikum noch viel zu früh geschrieben zu sein scheinet. In Frankreich und England würde es das äußerste Aufsehen gemacht haben; der Name seines Verfassers würde auf aller Zungen sein. Aber bei uns? Wir haben es, und damit gut. Unsere Großen lernen vors erste an den *** kauen; und freilich ist der Saft aus einem französischen Roman lieblicher und verdaulicher. Wenn ihr Gebiß schärfer und ihr Magen stärker geworden, wenn sie indes Deutsch gelernt haben, so kommen sie auch wohl einmal über den – Agathon. (111) Dieses ist das Werk von welchem ich rede, von welchem ich es lieber nicht an dem schicklichsten Orte, lieber hier als gar nicht, sagen will, wie sehr ich es bewundere: da ich mit der äußersten Befremdung wahrnehme, welches tiefe Stillschweigen unsere Kunstrichter darüber beobachten, oder in welchem kalten und gleichgültigen Tone sie davon sprechen. Es ist der erste und einzige Roman für den denkenden Kopf, von klassischem Geschmacke. Roman? Wir wollen ihm diesen Titel nur geben, vielleicht, daß es einige Leser mehr dadurch bekömmt. Die wenigen, die es darüber verlieren möchte, an denen ist ohnedem nichts gelegen.)
{ ‡ }
Siebzigstes Stück
Den 1sten Januar, 1768
Wenn in dieser Vergleichung, sage ich, die satyrische Laune nicht zu sehr vorstäche: so würde man sie für die beste Schutzschrift des komisch tragischen, oder tragisch komischen Drama, (Mischspiel habe ich es einmal auf irgend einem Titel genannt gefunden) für die geflissendlichste Ausführung des Gedankens beim Lope halten dürfen. Aber zugleich würde sie auch die Widerlegung desselben sein. Denn sie würde zeigen, daß eben das Beispiel der Natur, welches die Verbindung des feierlichen Ernstes mit der possenhaften Lustigkeit rechtfertigen soll, eben so gut jedes dramatische Ungeheuer, das weder Plan, noch Verbindung, noch Menschenverstand hat, rechtfertigen könne. Die Nachahmung der Natur müßte folglich entweder gar kein Grundsatz der Kunst sein; oder, wenn sie es doch bliebe, würde durch ihn selbst die Kunst, Kunst zu sein aufhören; wenigstens keine höhere Kunst sein, als
Weitere Kostenlose Bücher