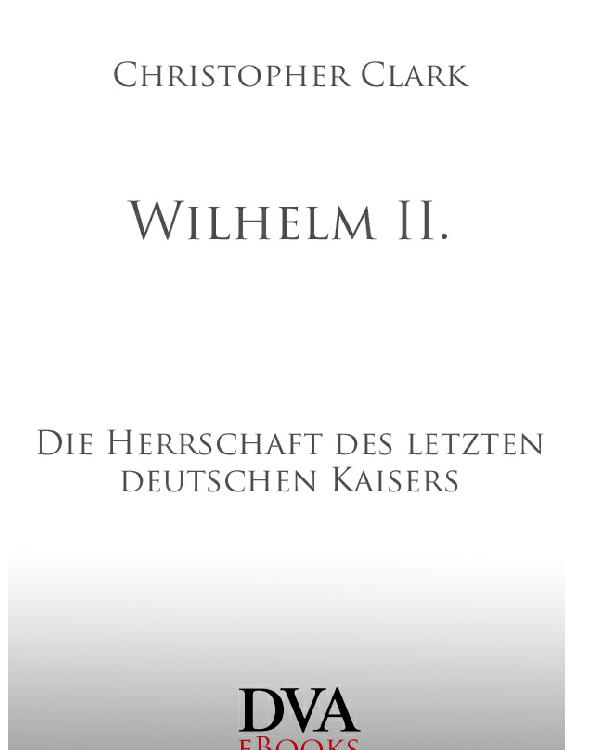![Wilhelm II]()
Wilhelm II
– zumindest seit Mitte Juli 1914 – einem mehr oder weniger einheitlichen Block aus politischen, militärischen und diplomatischen Beratern gegenüber, die allesamt den harten Kurs einer resoluten Militäraktion forderten. Weit davon entfernt, eine Meinungsvielfalt zu gewährleisten, machten die kollegialen Strukturen, die in Russland und Österreich über die Politik entschieden, es den Generälen eher leichter, ihre eigene Perspektive der zivilen Führung aufzudrängen und dadurch eine Homogenität der Anschauungen zu schaffen, die in Berlin fehlte. Dieses Phänomen war in Russland besonders stark ausgeprägt, wo die unablässigen Intrigen Wladimir Suchomlinows dazu beitrugen, dass der gemäßigte Regierungschef Graf Wladimir Kokowzow entlassen wurde und dass im Ministerrat die aggressiveren Stimmen überwogen. 114 An keinem einzigen Punkt stellten sich Nikolaus oder Franz Josef so unmittelbar gegen ihre militärische Führung wie Wilhelm am 28. und 31. Juli.
Wilhelm konnte das womöglich gerade deshalb tun, weil er sich dessen bewusst war, dass sich seine Anschauungen erheblich von denen der militärischen Führung unterschieden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Wilhelm, ungeachtet seines häufig großspurigen, militärischen Auftretens und seiner Vorliebe für Uniformen, den hohen Etagen des aktiven Militärs nicht sehr nahe stand. Seit Wilhelms Zerwürfnis mit Waldersee wegen der Handhabung der Manöver Anfang der neunziger Jahre hatte sich das Verhältnis abgekühlt. Und es war allgemein bekannt, dass die hohen Militärs der Unentschlossenheit und Zögerlichkeit des »Friedenskaisers« nicht trauten. Das militärische Gefolge erweckte den Anschein eines Kaisers, der ständig in Gesellschaft seiner Feldherren sei und von ihnen Rat empfange, aber in Wirklichkeit hatte das Gefolge schon seit langem tendenziell den gegenteiligen Effekt: Die langjährigen Mitglieder wurden zu »Hofsoldaten« mit weitgehend zeremoniellen
Pflichten und immer dünneren Bindungen zum aktiven Oberkommando. Wilhelm machte sich die Strategie eines »Präventivkriegs« nie zu eigen, die in regelmäßigen Abständen von Falkenhayn, Moltke und anderen Militärs vorgetragen wurde; er stellte sich die deutsche Antwort auf die russische Aufrüstung von 1913/14 lieber als defensive Vorkehrungsmaßnahmen vor, etwa den Bau eines undurchdringlichen Gürtels aus Festungen an der Ostgrenze. Zu keinem Zeitpunkt wandte er die Logik des Präventivkriegs auf die Probleme an, die im Juli 1914 auftraten. Er kannte den Schlieffen-Plan und wusste vermutlich, dass der Plan für einen Ostfeldzug im Jahr 1913 zu den Akten gelegt worden war, aber er weigerte sich, den Schlachtplan als in Stein gemeißelt zu betrachten. Er lehnte es ab, Moltkes Behauptung zu akzeptieren, der deutsche Mobilmachungsplan sei unveränderbar oder unumkehrbar, sobald er einmal in Gang gesetzt war. Mit anderen Worten, Wilhelm war weder ein Verfechter des »Präventivkriegs« noch des »Topos des unvermeidlichen Krieges«, den manche Historiker als einen Ausschlag gebenden Faktor für die Eskalation der Julikrise nennen. 115 Das erklärt nicht zuletzt seine Kritik an dem »Pessimismus« der österreichischen Diplomatie auf dem Balkan und den öffentlich geäußerten Wunsch, dass seine Herrschaft als eine Ära des europäischen Friedens in Erinnerung bleiben möge.
Dem könnte man entgegen halten, dass Wilhelm, selbst wenn er den europäischen Frieden wünschte, doch auch den Balkankrieg wollte, zumindest Anfang Juli 1914. Das trifft mit Sicherheit zu, und Wilhelm irrte sich, wenn er glaubte, dass man letzteren haben konnte, ohne ersteren zu gefährden. Ob die Legitimität der von Österreich gegen Serbien geplanten Aktion wirklich so dürftig war, wie Historiker im Allgemeinen annehmen, ist eine Frage, deren Beantwortung den Rahmen dieser Studie sprengen würde. Es mag der Hinweis genügen, dass die Forderungen Wiens aus der damaligen Sicht gewiss nicht drakonisch wirkten – sie stellten deutlich geringere Eingriffe in die souveränen Prärogative Belgrads dar als die Forderungen, die 1999 der serbischen
Delegation in Rambouillet zur Beendigung des Kosovokrieges vorgelegt wurden – und dass die serbische Antwort längst nicht so zufriedenstellend war, wie oft behauptet wurde. Auf jeden Fall steht fest, dass Wilhelm die österreichische Sache für gerecht hielt und dass er – ganz zu Recht – glaubte, dass diese Anschauung unter den
Weitere Kostenlose Bücher